Biffy Clyro: „Futique“
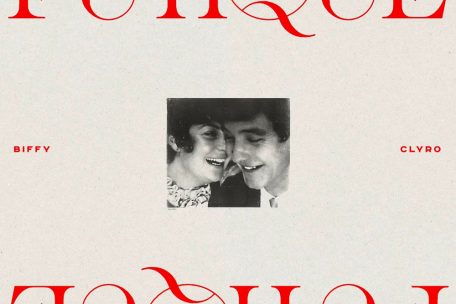
Was wir heute besitzen, kann in der Zukunft eine Antiquität sein: So in etwa kann der Albumtitel „Futique“ interpretiert werden, den sich das schottische Trio Biffy Clyro ausgedacht hat. Er setzt sich aus den Wörtern „future“ (Zukunft) und „antique“ (Antiquität) zusammen. Laut Frontmann Simon Neil sollte man den Moment, also das Hier und Jetzt, zu schätzen und zu genießen versuchen. Dieser Gedanke führte ihn zu der für dieses Album zentralen Frage: Was werde ich in der Zukunft vermissen, das mir heute wichtig ist? Womit wir bei „Futique“ wären …
„A Little Love“ ist ein vielversprechender Albumauftakt: energiegeladen, melodiereich und mit Neils gewohnt prägnanter Stimme. Auch das darauffolgende „Hunting Season“ hinterlässt einen guten Eindruck. Nach diesen beiden Singleauskopplungen werden Biffy Clyro mit dem gefälligen „Shot One“ fahriger. Die dritte Vorabauskopplung „True Believer“ versucht das wieder wettzumachen. Man darf aber nie vergessen, dass Biffy Clyro über die Jahre zu einer Stadion- und Arena-Band mutiert sind. Punktuell lassen sie es noch krachen, aber härtere, progressivere Klänge wie auf ihren ersten Alben sind nur ansatzweise zu erkennen.
Wer das akzeptieren kann und kein Wunder (der Rückverwandlung) erwartet, hat auch mit diesem Album seine Freude. „Futique“, das übrigens in Berlin aufgenommen wurde, hat einiges zu bieten: beispielsweise das spannende und beste Stück „Woe Is Me, Wow Is You“, das ruhig beginnt und als Dialog zwischen Neil und den anderen beiden Mitgliedern, den Brüdern James und Ben Johnston, angelegt ist und dann irgendwann ins Bombastische abbiegt. Nicht zu vergessen der Ohrwurm „Friendshipping“ und das mitreißende „It’s Chemical!“.
Paradise Lost: „Ascension“

Die aktuell wieder härteren Töne bei Paradise Lost zu begrüßen, heißt nicht zwangsläufig, die softere Seite der Band zu verteufeln. Damit gemeint ist jene Phase, als die Briten (spätestens ab Mitte der 90er) immer mehr in Richtung Sisters Of Mercy und Depeche Mode abdrifteten. Die 90er Jahre waren für alle Metalbands schwer zu verdauen, da sich die Musikindustrie auf den Grunge-Hype stürzte, dem der Nu Metal bzw. Crossover folgte. Die Plattenfirmen setzten plötzlich andere Prioritäten. Damals reagierten viele Metal-Acts verunsichert und etwas orientierungslos. Aber das ist lange her.
Paradise Lost lassen auf ihrem 17. Studioalbum erfreulicherweise ihre Doom- und Gothic-Metal-Anfänge auferstehen. „Ascension“, produziert von Gitarrist Gregor Mackintosh, eröffnet mit „Serpent On The Cross“. Der Song verzückt erst mit Doom-Klängen, bevor das Tempo angezogen wird und gleich der erste Höhepunkt gesetzt ist. Mackintoshs Gitarrenriffs sind auch im 37. Jahr nach Bandgründung noch unverwechselbar. Das wird auch in „Tyrants Serenade“ deutlich. Hier erinnern Nick Holmes’ Gesang und auch die Melodieführung insgesamt an Peter Steele und dessen ehemalige Band Type O Negative. In dem epischen „Lay A Wreath Upon The World“ verschmelzen sie schließlich ihren Gothic-Metal mit Akustikgitarre, Streichern und einer weiblichen Stimme.
Nicht jeder Song hat diese hohe Qualität, aber es enttäuscht auch kein einziger (siehe auch „This Stark Town“). Dieses Album katapultiert jeden langjährigen Fan zurück in die frühen 90er, als Paradise Lost sich dank „Gothic“ (1991), „Shades Of God“ (1992) und „Icon“ (1993) ein immer größer werdendes Publikum erarbeiten konnten.
Sprints: „All That Is Over“

Zu Beginn des letzten Jahres erschien ihr Debütalbum „Letter To Self“. Das heimste viele positive Kritiken ein, und plötzlich fanden sich die irischen Newcomer in den britischen Top 20 wieder. In der Folge gaben Sprints zig Konzerte, unter anderem im Vorprogramm von Fontaines D.C. Weshalb niemand damit rechnete, dass Sängerin Karla Chubb, Gitarrist Zac Stephenson, Bassist Sam McCann und Schlagzeuger Jack Callan jetzt schon ein Nachfolgewerk vorlegen würden. Aber da wurde die Rechnung ohne das agile, umtriebige Quartett gemacht.
Ebenfalls wenig verwunderlich ist, dass Album Nummer zwei teils im Tourbus und während des Soundchecks entstanden ist. Themen, die Chubb zu verarbeiten hatte, gab es auch genug: 2024 kam Stephenson für Gründungsgitarrist Colm O’Reilly, der Erfolg ihrer Band, deren Professionalisierung und die damit verbundenen Konsequenzen, der Gaza-Krieg, Trumps Politik und die vielen weiteren Schreckensmeldungen der letzten Monate. Obendrein musste sie nach achtjähriger Beziehung eine Trennung überwinden. So entstanden die neuen Songs aus Wut, Ehrgeiz und zig anderen Gefühlen heraus.
Folglich ist „All That Is Over“ kein durchweg wütendes Werk. Es beginnt sogar melancholisch, fast schon schlafwandlerisch („Abandon“). Wie im Rausch am Tag nach einer exzessiven Party. Dann aber sammeln sich Sprints und vereinen in „To The Bones“ ab der zweiten Minute ihre Kräfte. Die Verzerrer werden aktiviert und die Saiten hart angeschlagen. Sie servieren wieder fidelen Post-Punk, der schnell auf die Hörer überspringt. „Descartes“ und „Need“ lassen einen nahezu atemlos zurück. Aber Sprints funktionieren auch im Midtempo-Bereich, wie „Rage“ zeigt, ein Song, den die Band mit Cowboy Gothic umschreibt. Und Shoegaze steht ihnen auch sehr gut, zumindest im Fall von „Better“. „All That Is Over“ ist ein bunter Strauß.

 De Maart
De Maart







Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können