Unter dem Motto: „Méi a méi séier bauen“ stellte die Regierung am 19. Juni 2024 ihre Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung vor. Bis Ende 2025 soll demnach eine nationale Bauordnung („Règlement national sur les bâtisses“) ausgearbeitet werden. Derzeit gilt das Prinzip der Gemeindeautonomie. Die Kommunen sind also selbst für die Ausarbeitung ihrer Bauordnung verantwortlich.
Dies soll sich in Zukunft mit der nationalen Bauordnung ändern. Indem für alle Bauvorhaben dieselben Standards gelten, sollen der bürokratische Aufwand reduziert und das Bautempo erhöht werden. An dieser Stelle hat sich am Mittwoch das „Mouvement écologique“ eingeschaltet. In einer Pressekonferenz fordert die Umweltschutzorganisation, dass das zukünftige „Règlement national sur les bâtisses“ die Lebensqualität sowie Klima- und Biodiversitätsschutz stärker mit einbezieht. Sie schlägt unter anderem vor, die Renovation und Begrünung zu fördern sowie Regenwasser klüger zu trennen und zu nutzen.
Die Bauordnung einer Gemeinde beinhaltet eine Vielzahl technischer Vorgaben, die z.B. beim Bau einer Straße oder eines Gebäudes einzuhalten sind. Bisher hat das Innenministerium lediglich eine unterstützende Rolle eingenommen und den Kommunen eine Mustervorlage „Règlement-type“ zur Verfügung gestellt. Jede Gemeinde kann selbst entscheiden, welche Standards sie übernehmen will.
Das „Mouvement écologique“ legt den Fokus auf die Renovierung bestehender Gebäude und die Begrünung versiegelter Flächen. Claire Wolff ist für die Biodiversität zuständig. Sie warnt vor den negativen Folgen des Klimawandels wie Starkregen und Hitzetote. Vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen würden in stärker versiegelten Vierteln wohnen, deshalb stelle die Durchgrünung ebenfalls einen sozialen Aspekt dar. Während es inmitten der Wohnungskrise viel Leerstand gebe, würde die Regierung sich zu sehr auf den Neubau konzentrieren. Die unterschiedlichen Standards würden die Menschen davor abschrecken, ihre Gebäude zu renovieren, sagt Blanche Weber, Präsidentin des „Mouvement écologique“. Und: „Es führt dazu, dass die Menschen unterschiedlich behandelt werden.“

5 Fragen an Claire Wolff, Blanche Weber und Thécla Kirsch vom „Mouvement écologique“
Wie können technische Standards zum Klima- und Umweltschutz beitragen?
T.K.: Es muss zwischen den Standards beim Neubau und den Standards beim Altbau unterschieden werden. Beim jetzigen „Règlement-type“ wird hier nicht unterschieden. Das ist nicht sinnvoll. Ein Beispiel: Die Deckenhöhe war bis jetzt auf 2,55 Meter festgelegt. Bis vor kurzem waren es jedoch noch 2,50. Das heißt, wenn man jetzt z.B. zwei Räume miteinander verbinden möchte, muss das ganze Haus auf den neuen Standard von 2,55 Metern gebracht werden. Das zieht mit sich, dass auch die Treppen und die Fenster angepasst werden müssen. Das ist absurd. Es gibt jedoch Gemeinden, die vorgeben, dass nur der vom Umbau betroffene Teil den neuen Standards entsprechen muss. Das macht jedoch einen großen Unterschied. Es ist nachvollziehbar, wenn ein Bauherr eher alles neu baut, statt zu renovieren, sobald er merkt, dass er alles rausreißen muss. Doch damit haben wir umweltmäßig nichts gewonnen, weil ein Großteil der Energien in der Konstruktion stecken. Neue Passivhäuser zahlen sich erst nach 40 Jahren aus. Es ist nicht sinnvoll, Häuser jedes Mal abzureißen.
In welchen Gemeinden wirkt sich das „Règlement sur les bâtisses“ negativ auf die Umwelt aus?
B.W.: Wir wollen keine Gemeinde schlechtreden. Die Lichtverschmutzung ist z.B. insgesamt nicht gut geregelt. Das heißt nicht, dass die Lichtverschmutzung überall schlecht ist, aber die Vorgaben sind nicht gut.
C.W.: Hinzu kommt die Hitzeentwicklung. Wir merken jetzt schon in heißen Tagen, wie sehr Beton die Städte aufheizt. Die Zahl der Hitzetoten wird zunehmen. Deswegen müssen wir die Temperaturen in den Städten drosseln. Das geht zum Beispiel mit Baumpflanzungen. Hier könnten einheitliche Vorgaben dafür sorgen, dass die für die Bäume vorgesehenen Gruben so groß sind, dass die Bäumer nicht nach zehn Jahren eingehen, sondern länger leben und eine angemessene Baumkrone entwickeln können. Andere Maßnahmen sind die Fassaden- und Dachbegrünung. Damit könnte einerseits Starkregen besser abgefangen werden und andererseits die Biodiversität gesteigert werden.
All diese Maßnahmen sind derzeit nicht geregelt?
C.W.: Nein. Es gibt einzelne Gemeinden, die beispielsweise Schottergärten verbieten. Das könnte man auf die nationale Ebene bringen.
B.W.: Es gibt viele Gemeinden, die sich nicht trauen, eine Maßnahme zu ergreifen, da sie eine Absage vor dem Innenministerium fürchten. Es ist juristisch nicht klar geregelt.
Inwiefern?
B.W.: Bei den Schottergärten muss beispielsweise zwischen der individuellen Freiheit und dem Allgemeinwohl abgewogen werden. Schottergärten tragen zur Überhitzung der Ortschaften bei und sind problematisch für die Biodiversität. Es gibt jedoch noch kein Bekenntnis des Innenministeriums, dass Schottergärten abzulehnen wären.
Haben Sie dem Innenministerium Ihre Vorschläge schon unterbreitet?
B.W.: Anfang des Jahres hatten wir Kontakt mit den Zuständigen im Innenministerium und die Gespräche verliefen gut. Aber wir vermissen das politische Bekenntnis der Regierung.

 De Maart
De Maart



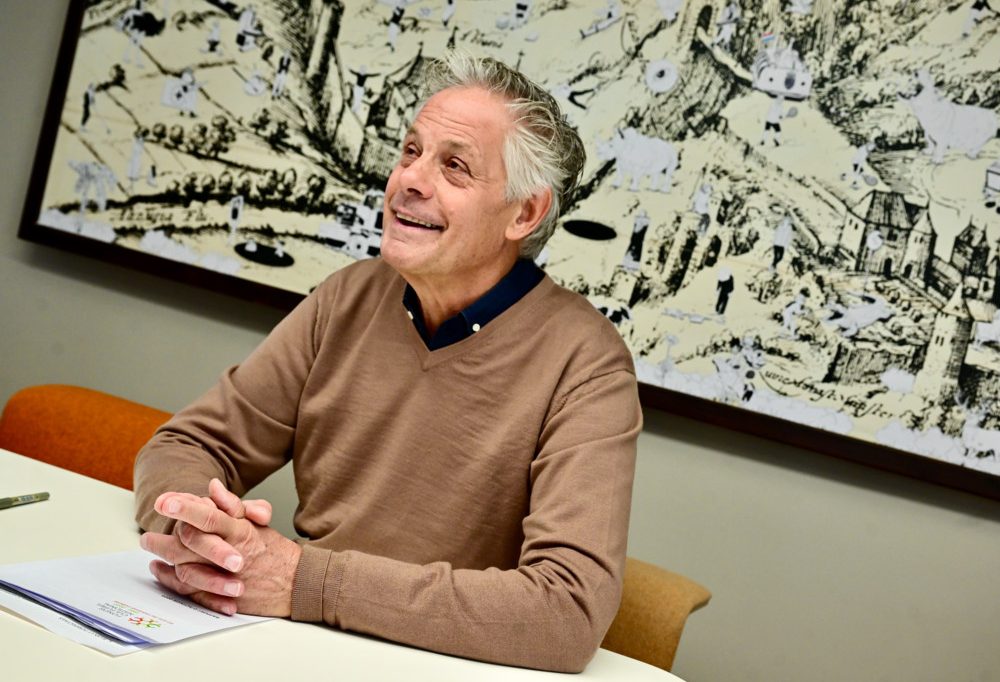





Waat déi Grünspechte do alles vun séch ginn,
gëtt ëmmer méi lächerléch an armsélég.
Emmer vill Palaver ower keng richtég Alternativ.
Ausnahmsweise hat das Mouvéco vernünftige und machbare Forderungen. Schön, dass das auch mal vorkommt.
UNsere gr{nen Schwärmer sollen sich aus dieser Angelegenheit mal raus halten die haben keinen Ahnung vom Bauen....das ganze Gelaber ist überflüssig!