Am 10. Juli hatten die FHL und die Gewerkschaften eine vorläufige Einigung zum Kollektivvertrag im Krankenhaussektor verkündet. Darin wurde festgehalten, dass Pflegerinnen und Pfleger rückwirkend für 2023 und 2024 eine Prämie erhalten und auch eine Punktwerterhöhung zur Berechnung ihres Gehalts um 1,5 Prozent erfolgt. Die AMMD greift diese Errungenschaften des Tarifkonflikts nun frontal an: „Diese zusätzlichen Ausgaben verschärfen das ‚strukturelle‘ Defizit der CNS erheblich, ohne greifbare Verbesserungen für die Patientinnen und Patienten vorzusehen: weder einen besseren Zugang zu notwendigen Untersuchungen oder Behandlungen, noch eine Verkürzung der Wartezeiten – insbesondere in den Notaufnahmen“, so die Ärzteorganisation.
OGBL und LCGB zeigen sich empört über die Wortwahl und Inhalte des Ärzte-Kommuniqués. Sie werfen der AMMD vor, die Belastung der Pflegekräfte zu ignorieren und ihre Leistungen herabzuwürdigen. Statt die dringend nötige Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu unterstützen, stelle die AMMD diese öffentlich infrage – und das inmitten einer europaweiten Pflegekrise.
„Wer behauptet, bessere Arbeitsbedingungen brächten den Patientinnen und Patienten keinen Nutzen, ignoriert die Realität auf den Stationen“, betonen die Gewerkschaften. Ein aufgewertetes Berufsfeld ziehe mehr Fachkräfte an, entlaste bestehendes Personal und verbessere so unmittelbar die Versorgung.
Verteidigung des Sozialmodells
Auch die Attacke auf den Verwaltungsrat der CNS weisen OGBL und LCGB entschieden zurück. Die AMMD hatte den Arbeitnehmervertretern einen Interessenkonflikt unterstellt, da sie gleichzeitig als Gewerkschafter den neuen Vertrag mit der FHL unterzeichnet hätten und im Verwaltungsrat der CNS vertreten seien. Die Gewerkschaften halten dagegen: Die Sozialversicherung funktioniere seit jeher nach dem Tripartite-Prinzip – getragen von Staat, Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Wer dieses Gleichgewicht infrage stelle, gefährde das Fundament des luxemburgischen Sozialmodells.
Zudem verweisen OGBL und LCGB auf den gesetzlichen Rahmen der Lohnanpassungen: Die im Juni ausgehandelten Gehaltserhöhungen orientieren sich am öffentlichen Dienst und sind im Artikel 28 der FHL-Kollektivvereinbarung fest verankert. Auch Gesundheitsministerin Martine Deprez (CSV) unterstrich diesen Umstand im Interview mit RTL. Die AMMD verkenne diesen Zusammenhang – und blende dabei aus, dass auch die freiberuflich tätigen Ärztinnen und Ärzte von den öffentlichen Investitionen in Spitäler profitieren.
Die Gewerkschaften kündigen an, die Verhandlungen nach der Sommerpause fortzusetzen. Ziel bleibe es, die Pflegeberufe langfristig aufzuwerten – mit besseren Bedingungen und mehr Anerkennung. (hat)

 De Maart
De Maart






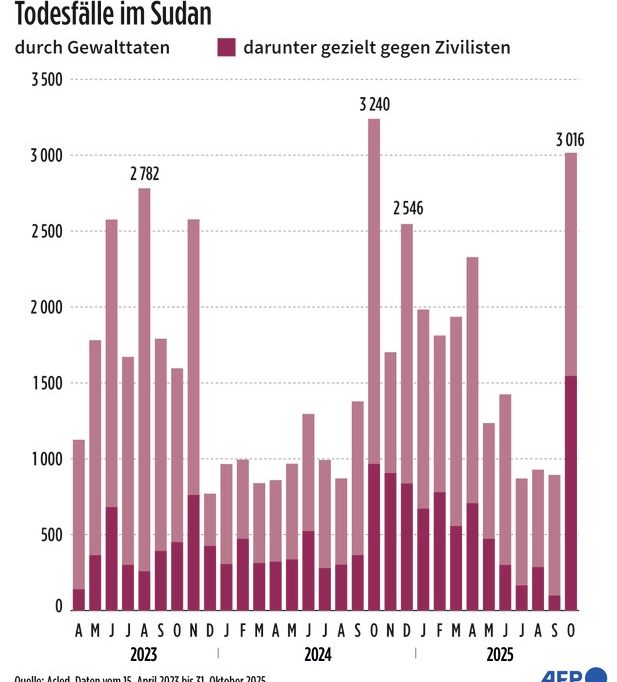
Der folgende Text betrifft auch Luxemburg seit 1933 wegen der Nazi-Propaganda im unfehlbaren päpstlichen "Luxemburger Wort". Der Sachverhalt muß von einer Wahrheits- und Versöhnungskommission aufgearbeitet werden.
▪Brandstifter der NS-Euthanasie (Eva SCHINDELE, sueddeutsche.de) (26.11.2016) Psychiater und Ärzte setzten keineswegs nur Befehle um - sie lieferten den Nazis die Rechtfertigung. 200.000 Menschen fielen dem "sanften Tod" im Dritten Reich zum Opfer. Es ist ein bedrückender Brief: "Wenn ich an unseren Garten mit den Obstbäumen, Beeren und Tieren denke, bin ich dem Heulen nahe", schreibt der 52-jährige Werkzeugschlosser Jacob GOLDSCHWEER im Sommer 1944 aus der Heilanstalt Meseritz-Obrawalde seiner Familie in Bremen. "Die Zustände hier sind schrecklich." Harte Arbeit, schlechte Behandlung, kaum etwas zu essen. In einem Sammeltransport war er von der Bremer Nervenklinik ein halbes Jahr zuvor in die Anstalt östlich von Berlin verfrachtet worden. "Damit kam er in den Strudel der Euthanasie", sagt die Kulturwissenschaftlerin Gerda ENGELBRACHT. Das griechische Wort bedeutet "sanfter Tod", der - so die Rechtfertigung - Kranke von ihrem "Leid erlösen" sollte. Vor allem aber wollte das kriegsführende Deutschland dadurch Kosten sparen. Mindestens 200.000 Männer, Frauen und Kinder, behinderte, unangepaßte, alte und schwache Menschen wurden zwischen 1939 und 1945 von denen ermordet, die sie eigentlich heilen, pflegen und beschützen sollten.
"Ohne die wissenschaftlich-ärztliche Elite hätte es diesen Massenmord so nicht gegeben", schreibt der Bielefelder Historiker Hans-Walter SCHMUHL in seiner 2016 erschienenen Dokumentation "Die Gesellschaft Deutscher Neurologen und Psychiater im Nationalsozialismus", in der er die Verstrickungen der Psychiater systematisch erforscht hat. Mit seiner Arbeit wird deutlich, daß sich Psychiater schon Jahre vor der Machtübernahme als geistige Brandstifter betätigten und die Konzepte lieferten, mit denen die Nazis ihre Rassenhygiene begründeten. Andere neue Analysen zeigen zudem, wie das Leugnen der eigenen Rolle auch noch nach dem Krieg jahrzehntelang die Öffnung der bundesdeutschen Psychiatrie blockierte. (…) Obwohl nach dem Krieg einzelne Überlebende vor Gericht aussagten, "wurde ihnen oft nicht geglaubt", so ENGELBRACHT. "Man hat gesagt, das sind doch Geisteskranke. Die haben sich das eingebildet." Und auch Angehörige, die Anträge auf Wiedergutmachung stellten, wie die Witwe Franziska GOLDSCHWEER, wurden abgeschmettert: "Ihr Mann war doch krank, und wer krank ist, kann auch sterben." Dabei war längst bekannt, dass Meseritz-Obrawalde eine Vernichtungsanstalt war. Die Anträge auf Wiedergutmachung wurden zum Teil von denselben Psychiatern begutachtet, die an den Zwangssterilisierungen und Tötungsaktionen beteiligt gewesen waren. Nicht erstaunlich, daß sie die Forderungen der Opfer und ihrer Angehörigen ablehnten. Manche dieser Experten wurden sogar noch 1961 im Bundestagsausschuß "Wiedergutmachung" gehört, unter ihnen der Psychiater Werner VILLINGER. Er war Beisitzer in Erbgesundheitsgerichten und "T4"-Gutachter, die nach Aktenlage entschieden, wer vergast werden sollte. Nach dem Krieg machte er Karriere - als Ordinarius in Marburg, später sogar als Rektor der Universität. 1958 war er Mitgründer der "Bundesvereinigung Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind", der heutigen "Lebenshilfe". "Es gab keine wirkliche Zäsur nach 1945", sagt der Psychiater Michael von CRANACH, der 1980 als junger Arzt von der bayerischen Bezirksregierung beauftragt wurde, die Nervenklinik in Kaufbeuren zu reformieren, eine der schlimmsten Tötungsanstalten. "Weder die Gesellschaft noch die meisten Ärzte wollten sich den Medizinverbrechen stellen." Noch bis weit in die 60er-Jahre galten psychisch Kranke als minderwertig, sie wurden stigmatisiert und hinter Anstaltsmauern weggesperrt. "Die Menschenrechte des Einzelnen spielten dabei eine untergeordnete Rolle", erinnert sich CRANACH, der während seiner Facharzt-Ausbildung in England eine humanere Psychiatrie kennengelernt hatte. Erst in den 1970ern begann man die Psychiatrie "vom Rand der Gesellschaft mehr in die Mitte zu holen", schreibt der Historiker Franz-Werner KERSTING vom "LWL"-Institut für Regionalgeschichte in Münster. Er ist Mitglied einer von der "Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde" (DGPPN) beauftragten unabhängigen Historikerkommission. Diese begleitet ein Projekt, das untersucht, wie die Medizinverbrechen nach dem Krieg aufgearbeitet worden sind - sowohl in der BRD als auch in der DDR. KERSTING meint, daß der Wandel erst durch die 68er-Bewegung und die Reformen der BRANDT-Ära möglich geworden sei. Eine Zäsur war die vom Bundestag beschlossene "Psychiatrie-Enquete" von 1975. In ihr wurde die "brutalen Zustände" innerhalb der Verwahrpsychiatrie angeprangert und empfohlen, große Anstalten zu verkleinern und zu modernisieren sowie ambulante, wohnortnahe Versorgungsstrukturen aufzubauen. Nach dem Krieg mußten nur wenige Ärzte für ihre Verbrechen büßen. Zu ihnen gehörte der Euthanasiebeauftragte Karl BRANDT, der im Nürnberger Ärzteprozeß zum Tode verurteilt wurde. Die wenigen Nervenärzte, die angeklagt wurden, beriefen sich auf den Befehlsnotstand. Die Psychiater, die über die Verbrechen der NS-Zeit berichteten, wurden von ihren Kollegen isoliert und als Nestbeschmutzer beschimpft, so etwa Gerhard SCHMIDT, später Professor in Lübeck. Er hatte die Zustände in der Nervenheilanstalt Haar bei München bereits Ende 1945 im "Bayerischen Rundfunk" bekannt gemacht. Seine Dokumentation, die Teil seiner Habilitation war, verschwand auf "mysteriöse Weise" - wie sich SCHMIDT noch Jahrzehnte später empörte. Er fand 20 Jahre lang keinen Verleger für seinen Bericht. Selbst unverdächtige Kollegen, wie der Philosoph Karl JASPERS, rieten von der Veröffentlichung ab. "Man wollte das ohnehin schon schlechte Image der Psychiatrie nicht noch weiter demontieren", so KERSTING. Über Jahrzehnte hinweg sei sich die "scientific community" einig gewesen, daß es zwar einzelne schwarze Schafe gegeben habe, die aus Karrierismus, Ehrgeiz, Opportunismus oder ideologischer Verblendung mitgemacht haben", so der Historiker SCHMUHL. Die Mehrheit der Ärzte und Forscher behauptete aber, unter Zwang gehandelt zu haben. "Geschichtsklitterung" nennt das SCHMUHL. ▪Die Ärzte arbeiteten aktiv an der Vernichtung mit Die Ärzte selbst hätten das Euthanasieprogramm weitgehend entworfen, die Durchführung geplant und evaluiert. Und die meisten Leiter von Behinderteneinrichtungen oder Nervenheilanstalten hätten mitgespielt: "Sie waren eine Stütze und kein Hemmschuh der Politik", bestätigt auch KERSTING. "Selbst die durchschnittlichen Psychiater hatten sich schon zu weit auf den NSZ-Berufsalltag und die Entwertung, Vernachlässigung und Ausgrenzung ihrer Schutzbefohlenen eingelassen." "Ballastexistenzen", "unwertes Leben", "ausmerzen" - diese Worte gebrauchte der Psychiater Alfred HOCHE in seiner Schrift "Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens", die er 1920 zusammen mit dem Rechtswissenschaftler Karl BINDING verfaßte. Für die Euthanasie kamen für ihn hirnverletzte Kriegsrückkehrer und "unheilbar Blödsinnige, die das Gegenbild echter Menschen bilden", infrage. Dieses Buch wurde damals unter Medizinern viel diskutiert. In diesen Jahren entwickelten Nervenärzte auch erste reformpsychiatrische Ansätze. "Sie waren vom therapeutischen Optimismus geprägt, verbunden mit der Enttäuschung, dass nicht jeder Patient geheilt werden kann", sagt der Psychologe Michael WUNDER. Die chronische Unterfinanzierung der Anstalten bei steigenden Patientenzahlen habe die Situation weiter verschärft. Das mag einer der Gründe sein, warum viele Nervenärzte, auch Reformpsychiater, schon früh eugenische Vorstellungen vertraten, die nur Gesunden und Leistungsstarken erlaubt, sich fortzupflanzen. ▪Damals sahen viele die Ursache der Erkrankungen in schlechten Genen Nach der Machtübernahme begrüßten viele Psychiater vor allem in den Heil- und Pflegeanstalten das "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" und "spielten eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung". Sie waren überzeugt, daß die eugenisch indizierte Sterilisierung auch für die Psychiatrie selber eine sinnvolle Maßnahme sei, so SCHMUHL. Endlich kam ein Politiker an die Macht, der unerwünschtes Leben "wegzüchtet". Man war sich einig, daß psychische Erkrankungen und geistige Behinderungen erblich bedingt seien. "Das Dritte Reich war ein politisches System, das Wissenschaftlern enorme Gestaltungsfreiräume eröffnet hat, ihre Ideen zur praktischen Umsetzung zu bringen", so SCHMUHL. Wer unter die Kategorie "Unwertes Leben" fiel, bestimmten vermeintlich rational argumentierende Naturwissenschaftler, wie der international angesehene Ernst RÜDIN, langjähriger Direktor der "Forschungsanstalt für Psychiatrie" in München und Präsident der Fachgesellschaft. Er sah die Ursache von psychischen Erkrankungen in schlechten Genen und blendete biografische und soziale Dimensionen völlig aus. Seine psychiatrische Genetik fußte auf Statistiken und war schon damals wissenschaftlich fragwürdig. Doch dieses Denken entsprach dem Zeitgeist, nicht nur in Deutschland. Allerdings zeigen Krankenakten, die erst nach der Wende in einem Ostberliner Archiv wieder aufgetaucht sind, daß bei Krankenmorden nach 1941 die Erbprognosen kaum noch eine Rolle spielten. Es zählte vor allem die Arbeitsfähigkeit. Nach dem Krieg wurden die Krankenmorde auch von den Angehörigen oft totgeschwiegen. Aus Scham, aus einer Familie mit "erblich Belasteten" zu stammen, aus Angst, selbst stigmatisiert zu werden, vielleicht auch aus Schuldgefühlen, die Verwandten nicht genug beschützt oder ihren Tod sogar befürwortet zu haben. Erst in den letzten Jahren lüften mehr und mehr Betroffene das Familienge-heimnis und holen ihre Großmutter, ihren Onkel oder ihre Schwester posthum wieder in die Familiengeschichte zurück. Auch der jüngste Sohn von Jacob GOLDSCHWEER wußte bis vor einigen Jahren nichts von dem Schicksal seines Vaters. Er war fünf als sein Vater in der Nervenheilanstalt umgebracht wurde. "Meine Mutter erzählte mir, er wäre in Rußland gefallen", so Franz GOLDSCHWEER. Dann fand er nach dem Tod seiner ältesten Schwester die Briefe seines Vaters aus Meseritz-Obrawalde, die sie sorgfältig in einer Schachtel im Schrank aufgehoben hatte. "Das hat mich erschüttert", sagt der inzwischen 79-Jährige. Seit einigen Wochen gibt es nun vor dem ehemaligen Wohnhaus der GOLDSCHWEERS in Bremen einen Stolperstein, der an seinen Vater erinnert. "Es ist für mich so, als sei er wieder nach Hause gekommen", meint Sohn Franz, der keine Erinnerung mehr an seinen Vater hat. "Öfters fahre ich jetzt dorthin und besuche ihn."
MfG, Robert Hottua