Die Coronapandemie liegt inzwischen bereits einige Jahre zurück. Während die einen mit dieser dunklen Zeit abschließen, bleibt sie für andere immer noch Alltag. Denn bis zu 30 Prozent der Infizierten leiden infolge ihrer Erkrankung an Long Covid. Hierbei handelt es sich um ein Sammelsurium an unterschiedlichen und möglichen Folgeerscheinungen. Darunter: die Myalgische Enzephalomyelitis/das Chronische Fatigue-Syndrom oder einfach ME/CFS genannt. Diese chronische Erschöpfung gehört zu den schwersten Ausprägungen von Long Covid. Und genau damit beschäftigen sich zwei Forscher von der Universität Luxemburg.

Prof. Dr. André Schulz (43), Psychologe, interessiert sich besonders für die Kommunikation zwischen dem menschlichen Hirn und dem Körper und welche Rolle der Faktor Stress dabei spielt. Ihm zur Seite steht die Doktorandin Nina Buntić (30), ebenfalls Psychologin.
„Wir glauben, dass diese Erschöpfung dadurch entsteht, dass Gehirn und Körper fehlerhaft miteinander kommunizieren“, erklärt Schulz. Diese Kommunikation basiere auf drei Pfeilern: erstens dem autonomen Nervensystem, zweitens den Hormonen, insbesondere den Stresshormonen, und drittens dem Immunsystem. Schulz und Buntić vermuten, dass auch die eigene Körperwahrnehmung, die auch Inteozeption genannt wird, eine wesentliche Rolle bei der Ausprägung und Entwicklung der Symptome spielt.
Menschen, die ihren Körper besser wahrnehmen, können sich besser auf Veränderungen einstellen, sie regulieren. Menschen, die unter ME/CFS leiden, neigen zu einer Überaktivierung des autonomen, insbesondere des sympathischen Nervensystems. Das bedeutet, sie reagieren übermäßig auf äußere Reize. Diese übersteigerte Reaktion trägt zu einer zunehmenden Erschöpfung bei. Anders bei den Hormonen: Betroffene hätten oft einen zu geringen Cortisolspiegel, was ihre Fähigkeit beeinträchtigt, Veränderungen und Stressoren – also äußere oder innere Reize, die eine Stressreaktion im Körper auslösen können – zu bewältigen.
Wenn jeder Schritt einer zu viel ist
ME/CFS gibt es allerdings nicht erst seit der Pandemie. „Chronische Fatigue wurde lange falsch verstanden und als psychische Störung klassifiziert“, meint Schulz. Obwohl es im deutschen Sprachraum Hunderttausende Betroffene gebe, wurde dem Krankheitsbild bisher nicht viel Beachtung geschenkt. Das habe sich mit der Pandemie jedoch fundamental gewandelt. „Als im Frühjahr 2020 bekannt wurde, dass viele Leute nach einer Covid-Erkrankung dieses Pattern aufzeigten, ist mir im ersten Moment klar gewesen, dass es sich hierbei um das handelt, was wir bereits als chronisches Erschöpfungssyndrom kennen“, sagt der Forscher.
Es handelt sich um eine multisystemische Erkrankung: Das bedeutet, dass mehrere Organsysteme gleichzeitig betroffen sind, was wiederum zu einer Vielzahl von Symptomen und Komplikationen führen kann. ME/CFS kann in sehr unterschiedlichen Ausprägungen auftreten. Manche Menschen schaffen es trotz allem, ihr Leben zu leben, einige sogar in leistungsfähigen Jobs, andere hingegen sind schwer bettlägerig: „Dann ist eigentlich jeder Schritt einer zu viel“, sagt Schulz.
Viele „Trigger“ während der Pandemie

ME/CFS ist eine stressbezogene Erkrankung. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie wieder verschwindet, sobald man sich ausgeruht und den Stress reduziert hat. Vielmehr trägt Stress zur Entstehung der Krankheit bei. Häufig führt erst ein „infektiöser Trigger“ zum Ausbruch, erklärt Schulz. Während der Pandemie war das oft das Coronavirus. Viele Infizierte erholten sich nach einigen Tagen bis Monaten von der krankheitsbedingten Erschöpfung – andere sind das Krankheitsgefühl jedoch nie losgeworden.
„Mittlerweile weiß man, dass es auch das sogenannte Post-Vac-Syndrom gibt, das sich von der Symptomatik relativ ähnelt“, bestätigt Schulz auf Nachfrage des Tageblatt. Chronische Beschwerden treten nach einer Covid-Impfung jedoch in sehr seltenen Fällen auf – verglichen mit den deutlich häufigeren Symptomen nach einer tatsächlichen Infektion. Dennoch müssten auch diese wenigen Fälle ernst genommen und nicht vorschnell als Impfskeptiker abgetan werden, betont Schulz. Doch letztendlich lasse sich kaum mehr nachvollziehen, was die Erkrankung tatsächlich hervorgerufen hat, da eine Infektion mit dem Covid-19-Virus trotz Impfung weiterhin möglich ist.
Anzahl der Betroffenen – unbekannt
Wie viele Menschen in Luxemburg tatsächlich betroffen sind, lässt sich nur schwer sagen. „Zuverlässige demografische Daten für Luxemburg hat man bislang nicht“, bedauert Schulz. Auch Schätzungen seien schwierig – rechnet man jedoch vorsichtig mit den Zahlen aus Deutschland, dürfte die Zahl der Betroffenen hierzulande im vierstelligen Bereich liegen. Allein knapp zehn Prozent der Long-Covid-Erkrankten leiden an chronischer Fatigue, ergänzt Buntić.
Anlaufstelle für Long Covid in Luxemburg
Wer drei Monate nach einer Corona-Infektion weiterhin unter Symptomen wie anhaltender Erschöpfung, Angstzuständen, „Brain Fog“, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, Atemnot, Herzproblemen, chronischen Schmerzen oder Geruchs- und Geschmacksverlust leidet (die Liste ist nicht abschließend), könnte von Long Covid betroffen sein. Nach dem Erstkontakt mit einem Allgemeinmediziner werden Betroffene in die Long-Covid-Sprechstunde des „Centre hospitalier de Luxembourg“ (CHL) überwiesen. Dort lassen sich die Symptome abklären und ein individuell abgestimmter, multidisziplinärer Behandlungsplan erstellen.
Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: https://www.chl.lu/fr/service/consultation-covid-long
„Für viele ist die Diagnose, so niederschmetternd sie auch ist, erst mal auch eine Erleichterung“, meint Schulz. Denn abgesehen davon, dass ME/CFS lange kaum Beachtung fand, erschwert auch die aufwendige Diagnostik eine verlässliche Erfassung der Betroffenen. Viele Patienten werden von einem Facharzt zum nächsten überwiesen – oft ohne greifbares Ergebnis.
Eine Diagnose erfordert letztlich die enge Zusammenarbeit zwischen Medizin und Psychologie, erklärt Buntić. Und selbst dann kann ME/CFS nur per Ausschlussverfahren festgestellt werden: Indem andere mögliche Erkrankungen Schritt für Schritt ausgeschlossen werden – daher die Bezeichnung „Ausschlussdiagnose“.
Auf der Suche
Gerade weil Ursachen und Auslöser schwer zu greifen sind, ist die laufende Studie der beiden Uni.lu-Forscher von besonderer Bedeutung. Bis heute gilt ME/CFS als unheilbar, Therapien gibt es auch keine, und „da ist auch keine wirkliche Aussicht auf Spontanheilung“, meint der Forscher. Schulz, Buntić sowie ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter Prof. Dr. Jochen Schneider und Dr. Marc Schlesser versuchen mit ihrer komplett von der Universität finanzierten Studie, die Mechanismen hinter ME/CFS zu verstehen. Sollte ihnen das gelingen, könnten ihre Ergebnisse zur Entwicklung wirksamer Therapien beitragen.
Für die Studie werden weiterhin Teilnehmende gesucht, insbesondere gesunde Personen ohne akute oder chronische Erkrankungen – idealerweise Frauen zwischen 35 und 65 Jahren und Männer zwischen 53 und 65 Jahren. Die Teilnahme umfasst unter anderem das Ausfüllen mehrerer Fragebögen, verschiedene Tests im Labor der Universität sowie eine Blutentnahme. Auch Menschen, die bereits vor der Pandemie an ME/CFS erkrankt waren, werden noch gesucht. Insgesamt wird ein Pool aus rund 150 Teilnehmern anvisiert.
„Gesunde sind genauso wichtig, um eine Krankheit zu verstehen, wie die Kranken. Somit kann im Prinzip jeder seinen Teil beitragen“, meint Schulz.
Kontaktstelle
Bei Interesse oder Fragen zur Teilnahme an der Studie wenden Sie sich per E-Mail ([email protected]) oder per Telefon (+352 46 66 44 4697) an Nina Buntić.

 De Maart
De Maart


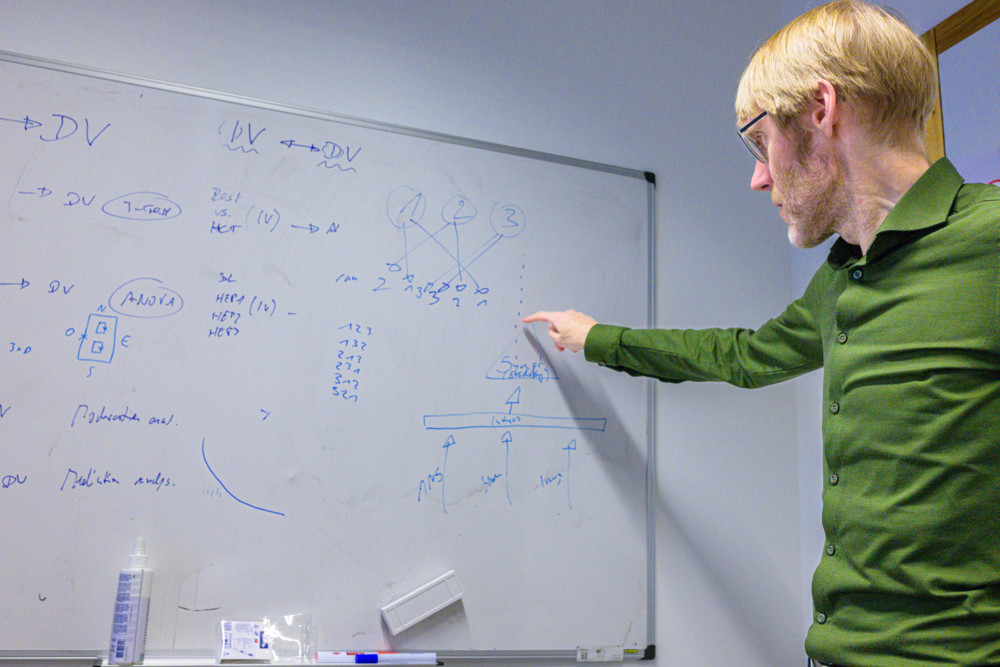




















Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können