Er hat den Goldenen Löwen von Venedig gewonnen, den Goldenen Bären in Berlin, nun gewann er die Goldene Palme: Gegen die starke Konkurrenz der Filme des Brasilianers Kleber Mendonça Filho und des Norwegers Joachim Trier, setzte sich am Ende der Iraner Jafar Panahi durch und bekam für seinen Film „Un simple accident“ in Cannes den Hauptpreis. Das Tageblatt berichtete am Samstag.
Die Auszeichnung ist, zumindest ein wenig, auch ein weiterer Triumph für das luxemburgische Kino, nachdem bereits im Vorjahr der indische Film „All we imagine as light“ von Payal Kapadia mit dem Grand Prix du Jury ausgezeichnet worden war. „Un simple accident wurde vom Film Fund Luxembourg als internationale Koproduktion gefördert und der Luxemburger Produktionsfirma Bidibul Productions von Christel Henon koproduziert. „Diese Auszeichnung ist ein historischer Moment für Luxemburg und bestätigt die Stärke unseres Filmschaffens“, kommentierte Guy Daleiden, Direktor des Film Fund Luxembourg, den Gewinn am Wochenende. Seit 1989 wurden 49 Filme mit luxemburgischer Beteiligung in Cannes gezeigt, davon drei in diesem Jahr. Insgesamt errang der luxemburgische Film bisher schon 15 Preise.
Um was es geht
Was tun mit Folterknechten? Was ist Gerechtigkeit? So könnte man die beiden Leitfragen von Panahis neuem Film zusammenfassen. Schon aus diesen Fragen geht hervor: Der Film ist ein Lehrstück. Eine Parabel auf die politischen Verhältnisse im Iran, mit einem grundsätzlichen Schwarz-Weiß-Schema, das aber viele Grautöne zulässt.
Die Story dreht sich um einen ehemaligen politischen Häftling, der überzeugt ist, dass es sich bei einer Zufallsbegegnung um seinen ehemaligen Folterknecht handelt. Er ist zunächst entschlossen, den Mann aus Rache für das, was der ihm einst angetan hatte, zu töten und entführt ihn. Doch dann wachsen Zweifel: Ist es wirklich der, für den er ihn gehalten hat? Der Entführte leugnet hartnäckig und nennt Indizien, die zu seinen Gunsten sprechen. Sein Entführer zögert und kontaktiert weitere ehemalige Leidensgenossen.
Historischer Moment für Luxemburg
In der zweiten Hälfte des Films befinden sich dann gleich fünf ehemalige Opfer des Regimes im Minibus des Entführers, sowie ihr Gefangener, der in einer Kiste eingeschlossen seinem Schicksal hart – eine ebenso grausame, wie absurd komische Situation. Denn die Kidnapper sind sich zum Teil ganz sicher, zum Teil überaus unsicher, ob es sich um ihren ehemaligen Schergen handelt – manche von ihnen konnten ihre Folterer nämlich nie sehen, sondern nur hören und riechen.
Hier stellt der Film elementare Fragen nach Wahrheit und dem Verhältnis von Anschein und Wirklichkeit. Doch selbst wenn es sich um den Gesuchten handeln sollte – was tun? „Auge um Auge“ und Bestrafung des Täters? Oder Verzeihen? Panahi stellt die Frage nach den Grenzen des Mitgefühls und danach, ob das Böse tatsächlich so banal ist, wie oft behauptet wurde. Sind die Handlanger der Macht menschliche Wesen, oder bloß Werkzeuge einer unmenschlichen Maschinerie? Oder Monster?
Originelle Fabel
Stilistisch betonen Anspielungen auf Beckett das Theatrale, Abstrakte von Film und Drehbuch. In mehreren Momenten nimmt alles auch Züge einer Komödie an, ohne je den Ernst der Situation zu übertünchen: Was tun mit einem Folterer? Der Regisseur entwickelt dieses Streitgespräch durch teils surreal anmutende, aber gemäßigt unterhaltsame Szenen. Am Ende entsteht eine originelle Fabel über Rache und Vergebung, über die Verantwortung der Täter und die Moral der Opfer – bis schließlich die Humanität siegt, der Film aber nicht vergessen lässt, dass Terror und Tyrannei im Iran (und nicht nur dort) weiterhin gegenwärtig sind.
Das Ergebnis ist ein sehr guter Film, dem doch auch bis zum Ende etwas Akademisches und „Trockenes“ anhaftet. Andere Filme im Wettbewerb waren hingegen pulsierendes, leidenschaftlicheres Kino.
So mag diese Preisvergabe auch politisch motiviert sein – was im Fall Panahis, der seit Jahrzehnten vom Mullah-Regime drangsaliert und mit Hausarrest und Berufsverbot überzogen wird, nur ehrenwert wäre –, als auch einen bequemen ästhetischen Kompromiss repräsentieren, mit dem die Jury harten Entscheidungen über Geschmacksfragen auswich. Die interessanten Debatten des cinephilen Teils der Cannes-Besucher kreisten eher um anderes, das mit Silbernen Palmen abgespeist wurde: „Sirat“ von Olivier Laxe, „Sound of Falling“ von Masha Schilinski und „Resurrection“ von Bi Gan. Panahis Film vereinte dagegen alle in einem perfekten Kompromiss.


 De Maart
De Maart





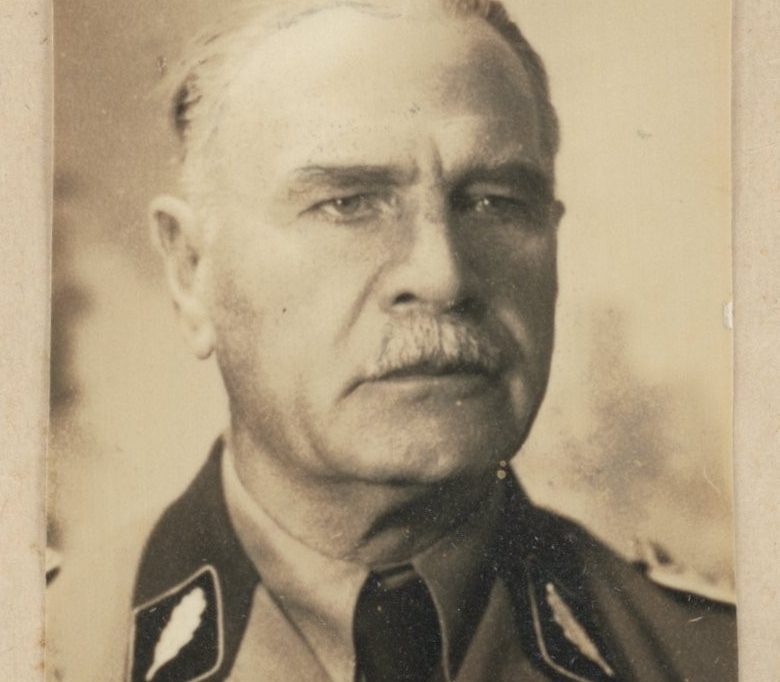

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können