Die Rebschule in Wellenstein ist sein „Bébé“, wie Carlo Faber sagt. Lebenswerk nennen es andere. Wie viele an der Mosel wächst er mit Wein auf. Schon sein Vater beliefert die Domaine Vinsmoselle, die Genossenschaft mit heute rund 180 Mitgliedern. Wer mit dem Kulturgut infiziert ist, den scheint es nicht loszulassen.
93-jährig schaut der Vater immer noch täglich vorbei und besucht Sohn und Enkel Sam (34), der im Betrieb mithilft. Carlo besucht damals nach der Schule die BBS Rheinpfalz, die Weinbaufachschule in Trier. Weinveredelung gehört zum Lehrstoff und er kommt zum ersten Mal mit der Vermehrung von Rebstöcken in Kontakt. Das Wissen wird er später brauchen.
Als er vor etwas mehr als 40 Jahren in den väterlichen Weinbetrieb einsteigt, bahnt sich eine große Flurbereinigung an. Die Flächen werden neu geordnet und nicht nur er, auch Kollegen, brauchen neue Weinstöcke. Er setzt das frisch Erlernte ein. 10.000 neue Stöcke braucht er selbst, 20.000 veredelt er insgesamt damals, um Qualitätssicherheit zu haben. Übrig gebliebene Stöcke verkauft er anschließend an Kollegen.

Weinveredelung wird ein Jahr im Voraus gedacht
„Das war ein schönes Taschengeld“, sagt er. Und eine wertvolle Erfahrung. Die Rebschule nimmt ihren Lauf. Heute beliefert er Kunden aus dem Land, Deutschland, Frankreich, Belgien bis nach Großbritannien. Auf die Insel gehen hauptsächlich Chardonnay- und Pinot-Noir-Rebstöcke. Es sind zwei der 60 verschiedenen Sorten, die er produziert. Weinveredelung ist ein Geschäft, das ein Jahr im Voraus gedacht wird.
Die Produktion 2025 kommt 2026 auf den Acker, der Absatz ist immer mit Unsicherheiten behaftet. In manchen Jahren könnte er weit mehr als die durchschnittliche, jährliche Menge von rund 400.000 Stück verkaufen. In einem anderen Jahr hat er nicht genug von einer Sorte, die gerade „hip“ ist.
Oder es werden mehr „lockerbeerige“ Rebstöcke nachgefragt, als er hat, weil die weiter auseinander hängenden Trauben bei Regen weniger schnell faulen. Vier Prozent der gesamten Anbaufläche eines Winzerbetriebes sollten jährlich erneuert werden. „Ab 35 Jahren Lebensalter nimmt der Ertrag beim Rebstock ab“, sagt Faber, obwohl die Qualität der kleineren Mengen sehr gut ist.

Nachfolgeregelung ist im Gang
Mit „Vieille Vigne“ sind solche Weine auf den Flaschen gekennzeichnet und haben ihren Preis. Faber lebt gut von der Pflege der Anbauflächen durch die Winzer, ist aber im Rentenalter. Zwar hilft Sohn Sam, das tut er eher im Büro. „Das Handwerkliche liegt mir nicht so“, sagt der Junior offen. Den „grünen Daumen“ seines Vaters hat er nicht geerbt. Leider, denn Arbeit gibt es genug. Die Rebschule läuft, hat Reputation und sie könnte bald so etwas wie eine Alleinstellung an der Mosel haben.

Nicht nur der Lebensweg des Seniors, sondern auch die Versammlungen des Berufsverbandes zeigen eine Entwicklung auf. Früher, erzählt Carlo, kamen viele Rebenveredler zusammen. „Heute sind entlang der Mosel noch drei mit mir übriggeblieben“, sagt er. „Und bei zweien ist die Zukunft unsicher.“ Inzwischen gibt es Gespräche mit mehreren Interessenten für seine Rebschule und er wird den potenziellen Nachfolger begleiten.
Das ist ihm wichtig und überstürzt wird sowieso nichts. „Ich bin körperlich noch fit“, sagt er. In den vier Jahrzehnten, in denen er sein Metier aufgebaut hat, konnte er Veränderungen beobachten. Früher war Wellenstein ein Winzerdorf durch und durch. Vor 50, 60 Jahren gab es etwa 100 Winzerbetriebe. „Fast in jedem Haus wohnte ein Winzer“, sagt Faber.
Viele Veränderungen prägen den Weinbau
Heute sind vielleicht noch eine Hand voll übriggeblieben. „Wenn überhaupt“, sagt er. Zu den Zeiten wurde anders gearbeitet. Hauptsorten waren Rivaner und Elbling. Sie wurden in Hektolitermassen, oft per Tanklaster vor Ort, beim Abnehmer abgefüllt. „60 Prozent der Weinbaufläche waren darauf ausgerichtet“, sagt Carlo Faber und schätzt: „Heute macht die Fläche von Rivaner vielleicht noch 10-15 Prozent aus“.

Er wurde vielerorts durch Burgundersorten ersetzt. Wo er noch angebaut wird, wie in der Domaine Tageblatt, geht es um Klasse statt Masse. Eine weitere Besonderheit kommt hinzu. Schon immer leidet der luxemburgische Wein darunter, nicht genug geschätzt zu werden. 2022 gab es den „Peak“. Es wurde erstmals mehr ausländischer Weißwein pro Kopf im Land verzehrt als einheimischer.
Die Gründe sind vielschichtig und von Widersprüchen geprägt. Einerseits ist die Bevölkerungszahl über die letzten Jahrzehnte gestiegen, was enormes Potenzial für den Genuss des luxemburgischen Weines ergibt. Andererseits ist im gleichen Zeitraum das Angebot im Handel gewachsen. „Es gibt Wein aus jedem Erdteil im Regal“, sagt Faber. „Die meisten ausländischen Mitbürger greifen aber zum Wein aus ihrer Heimat und lassen den luxemburgischen stehen.“

Absatzschwierigkeiten nicht nur national
Dabei ist „regional“ gerade in aller Munde. Das gilt auch für die Gastronomie. Sie ist vielfach in französischer Hand und verkauft oftmals lieber die Weine aus der Heimat als luxemburgische – auch wenn sie auf der Karte des Restaurants stehen. „Das ist ein großer Nachteil für uns“, sagt Faber. Weltweit gibt es ebenfalls eine Entwicklung, die Sorge bereitet.
Es ist zu viel Wein auf dem globalen Markt. Faber führt das zu einer ernüchternden Einschätzung. „Ich denke, die Weinbaufläche in Europa wird sich in den nächsten 20 Jahren halbieren“, sagt er. „Die Weinpreise sind im Keller, deshalb muss etwas passieren.“ Dieser Trend geht an der luxemburgischen Seite der Mosel nicht vorbei.

 De Maart
De Maart







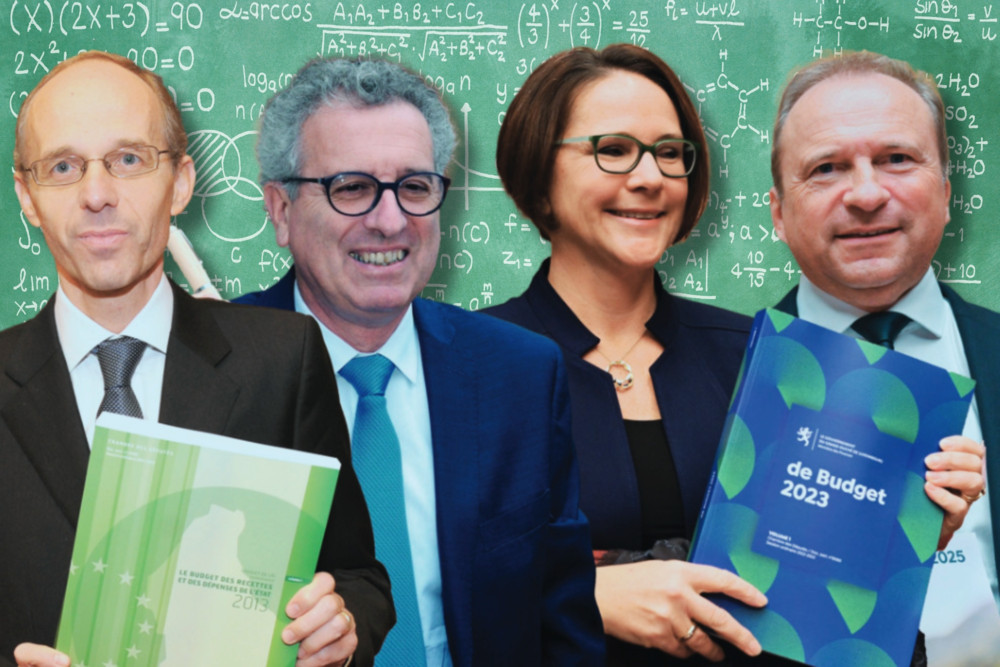



Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können