Mitte Dezember 1944 wird ein US-Panzer auf der Höhe der Lëpschter-Dellt (auf der heutigen Nordstrooss) durch eine deutsche Panzerfaust zerstört. Obschon die Alliierten Luxemburg im September eigentlich befreit haben, bestätigt der Angriff die Annahmen der Dorfbewohner*innen: Die Wehrmacht ist zurückgekehrt und deutsche Soldaten verstecken sich in den Wäldern der Gemeinde Burscheid.
Die Gemeinde Burscheid unter Beschuss
Auf der Suche nach Sicherheit ziehen am 17. Dezember 1944 die ersten Zivilist*innen aus der Umgebung westlich in Richtung Heiderscheid. Unter den Flüchtlingskolonnen befinden sich auch deutsche Fahrzeuge. Der Pfarrer schickt die Kirchenbesucher*innen vorsichtshalber zurück nach Hause. In Kehmen angekommen, teilt die damals ca. 14-jährige Catherine Huberty der ahnungslosen Familie und Nachbarschaft die Neuigkeiten mit und stellt diese vor eine schwierige Wahl.
Da die Hauptverkehrsachsen unter ständigem Artilleriefeuer stehen, müssen die Schutzsuchenden auf Nebenwege ausweichen, was ihre Flucht erschwert. Doch von Diekirch, Ettelbrück und Fuhren über Selz und Welscheid fliehende Zivilist*innen warnen ausdrücklich vorm Anrücken der Wehrmacht. Die Hoffnung liegt auf den US-amerikanischen Truppen, doch das trübe und neblige Wetter erschwert es den Alliierten, ihre Luftstreitkräfte gezielt einzusetzen, um so ihre Bodentruppen effektiv zu unterstützen. So ziehen sich die Amerikaner am 18. Dezember von Lipperscheid zurück. Bereits am darauffolgenden Tag kreuzen die ersten deutschen Soldaten in Welscheid auf. Sie erkundigen sich nach den US-Amerikanern, bevor sie ihren Weg weiter nach Niederfeulen fortsetzen.
Flucht nach Welscheid
Die Serie
In der Rubrik „E Bléck duerch d’Lëns“ liefern die Historiker*innen André Marques, Julie Depotter und Jérôme Courtoy einen facettenreichen Blick auf verschiedene zeitgeschichtliche Themen.
Am 19. Dezember wird Kehmen von amerikanischen Geschützen beschossen. Die Dorfbewohner*innen sind ihrem Schicksal überlassen und müssen zusehen, wie ihre Häuser zerstört werden. Die Familie Huberty muss wegen fehlendem Versteck Zuflucht im Keller ihrer Nachbarn, der Familie Mailliet, suchen. Als das Artilleriefeuer weiter zunimmt und auch dieses Versteck getroffen wird, bleibt den Familien nichts als die Flucht übrig.
Ohne Zeit zum Packen begeben sie sich unter anhaltendem Beschuss und in eisiger Kälte ins Tal nach Welscheid. Im Dorf finden Catherine Huberty und ihre Familie Schutz im Keller des Anwesens der Familie Majerus. Doch bereits früh am nächsten Morgen stehen mehrere Häuser auch in Welscheid in Flammen. Die zunehmende Gefahr macht ein Verbleiben im Schuppen unmöglich. Die Familie Huberty plant, in ihr Heimatdorf Kehmen zurückzukehren, doch die anderen Flüchtlinge raten von diesem lebensgefährlichen Unterfangen ab. Die Familie entscheidet, sich der weiteren Flucht nach Warken anzuschließen und findet dort Unterschlupf im Haus der Familie Steichen-Probst.

Leben im Keller
Am 20. Dezember 1944 fallen die ersten deutsche „Fußsoldaten, jeden Alters und in erbärmlicher Ausrüstung“ ins Dorf ein, der sogenannte „Volkssturm“. Welscheid entwickelt sich zum Kriegsschauplatz mit regelmäßigem Artilleriebeschuss. Die verbliebenen Zivilist*innen laufen panisch in die Hügel oder suchen Unterschlupf in den wenigen unbeschädigten Kellern, wo sie sich in Sicherheit glauben. Die Familie Derneden ist eine der wenigen, die weiterhin in Welscheid verbleibt. Von deutschen Soldaten lernte die 16-jährige Tochter der Familie, Lucie Derneden, sich vor Splittern zu schützen: weg von Fenstern und Türen, bis das Feuergefecht geendet hatte. Doch der heftige Beschuss zwingt die Familie, ein neues Versteck zu suchen. Als der Granatenhagel im Laufe des Tages zunimmt, bleibt den Menschen keine andere Wahl, als ihre Häuser zu verlassen.
Im Keller der Familie Malget, eine der wenigen sicheren Zufluchten, finden Lucie und ihre Familie sowie zahlreiche weitere Menschen auf der Flucht Unterschlupf. Das unterirdisch gelegene Versteck besteht aus zwei Bereichen, von denen der hintere von deutschen Soldaten als Lazarett für verletzte Kameraden genutzt wird. Das Zusammenleben erweist sich als besonders schwierig, da das Stöhnen der Verletzten und Sterbenden den Zivilist*innen zu schaffen macht. Auch Weihnachten verbringen sie in Angst und Schrecken, da das aufklärende Wetter zu einem intensiveren Artilleriebeschuss führt. Im Keller feiern die Soldaten ihre gelungene Abwehr von US-amerikanischen Angriffen – einer wird mit dem Eisernen Kreuz für seinen Abschuss von zwei US-Panzern ausgezeichnet.
„Alle wollten über die Wark“
Um den 30. Dezember 1944 erreichen neue und besser ausgerüstete deutsche Soldaten das Dorf und läuten eine neue Phase des Kampfes ein. Sie fordern allen Zivilist*innen auf, den Keller zu räumen. Der Arzt widersetzt sich der Aufforderung und schützt somit die zivilen Insassen. Die anderen noch verbliebenen Dorfbewohner*innen haben dieses Glück nicht und sehen sich vor dem zunehmenden Artilleriefeuer zur gefährlichen Flucht gezwungen.
Sie fliehen mit ihren Wägen durch das Warktal, um in die nächstgelegene Stadt Ettelbrück zu gelangen. Auf ihrem Fluchtweg werden die Schutzsuchenden allerdings von den Alliierten unter Beschuss genommen, da diese getarnte feindliche Soldaten innerhalb der Flüchtlingskolonnen vermuten. Als die Kolonnen die Wark erreichen, bemerken sie, dass die zwei Brücken über den Fluss gesprengt worden waren. Die weitere Flucht nach Ettelbrück wird somit unmöglich und die eingekesselten Flüchtlinge werden Opfer eines Artilleriebeschusses. Die erste Granate kostet fünf Zivilist*innen das Leben: die 12-jährige Louise Olsem, die 14-jährige Anna Brochmann sowie ihre Mutter Leonie Brochmann-Lehnerts, und die aus Reisdorf geflohenen Jean Weiler und die schwangere Marguerite Hientgen-Tholl. Der ebenfalls getroffene Alphonse Steichen verstirbt in einer Klinik in Luxemburg-Stadt an den Folgen der Splitter. Eine auf Privatinitiative errichtete Gedenktafel erinnert heute an die Verstorbenen.
Lesen Sie auch:
E Bléck duerch d’Lëns / Fluchtgeschichten aus der Gemeinde Burscheid (Teil 2)

 De Maart
De Maart






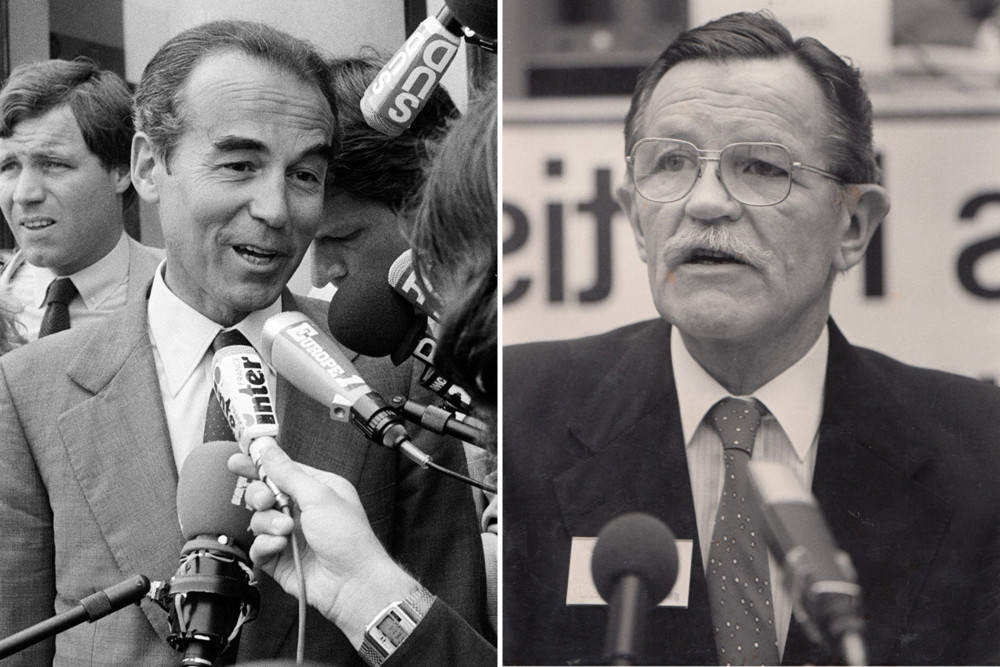




Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können