Tageblatt: Herr Präsident, Polen übernimmt am 1. Januar die EU-Ratspräsidentschaft. Sie haben kurz vor Weihnachten bei der Einweihung der Notre-Dame Emmanuel Macron in Paris getroffen, und auch aus Berlin hört man, dass man die Beziehungen zu Polen stärken will. Wie schauen Sie auf das Weimarer Dreieck?
Andrzej Duda: Ich glaube, dass jedes Format der Zusammenarbeit sehr wertvoll ist und ich weiß alle Initiativen zu schätzen, die innerhalb der Europäischen Union entwickelt werden. Das Weimarer Dreieck bringt drei große europäische Länder zusammen, Polen, Deutschland und Frankreich. Das ist eine wichtige, horizontale Dimension der Zusammenarbeit. Das andere wichtige Format ist die Drei-Meere-Initiative, sie ist die vertikale Dimension, vom Norden bis zum Süden Europas.
Ein von Polen initiiertes Format, das die Zusammenarbeit von 13 Staaten, die von der Ostsee über das Schwarze Meer bis ans Mittelmeer reichen, koordinieren soll.
Genau, wir haben diese Initiative 2015 zusammen mit meiner damaligen kroatischen Amtskollegin Kolinda Grabar-Kitarović gegründet. Beide Formate sind sehr wertvoll. Und ich glaube, dass sie die EU stärken können.
Gleichzeitig hat Russland in Syrien gerade eine Niederlage zu verkraften: Assad ist weg, und damit auch der russische Zugang zum Mittelmeer. Welche Konsequenzen sehen Sie aus diesen Vorgängen für den Krieg in der Ukraine?
Der Rückzug aus Syrien zeigt uns: Russland kann nicht an zwei Fronten Krieg führen. Wladimir Putin war nicht mehr imstande, Assad zu unterstützen und hat Syrien opfern müssen.
Befürchten Sie, dass Russland aufgrund des Rückzugs aus Syrien die Offensive in der Ukraine verstärkt?
Das glaube ich nicht. Russland hat nicht die nötigen Ressourcen dafür. Wenn wir nach den Gründen für den Rückzug aus Syrien suchen, spielt die Angst vor dem künftigen amerikanischen Präsidenten eine große Rolle. Russland versucht, sich offensichtlich für mehrere Szenarien zu wappnen und militärische Ressourcen bereitzustellen.
Es gibt nur zwei Präsidenten auf der Welt, vor denen Wladimir Putin wirklich Angst hat: der chinesische Präsident Xi Jinping und Donald Trump
Polen ist ein Nachbarstaat der Ukraine, wie präsent ist der Krieg bei Ihnen?
Der Ukraine-Krieg ist nach wie vor eine Gefahr für Polen. Schon mehrmals haben Raketen unseren Luftraum verletzt, eine ist bisher auf polnischem Boden eingeschlagen. Es gibt nach wie vor eine Reihe russischer Provokationen im Ostseeluftraum: Da Polen bei der Luftraumverteidigung der drei baltischen Staaten mitmacht, fliegen unsere oder alliierte Militärjets praktisch täglich dorthin, um die Russen aus diesem Luftraum – den polnischen mit eingeschlossen – zu vertreiben. Zudem sind in den letzten bald drei Jahren viele Flüchtlinge aus der Ukraine zu uns gekommen, im Moment sind es noch knapp eine Million. Viele Polen haben diese Menschen bei sich zu Hause aufgenommen und viele helfen ihnen auch heute noch. Ich bin sehr stolz auf meine Landsleute, wie sie ihre Herzen und ihre Häuser geöffnet haben.
Amerika bekommt einen neuen Präsidenten. Sie sind einer der wenigen Staatspräsidenten in Europa, die Donald Trump schon während seiner ersten Amtszeit erlebt haben. Was halten Sie von seiner Ankündigung, den Krieg in der Ukraine möglichst rasch zu beenden?
Donald Trumps Denkweise ist untypisch für einen Politiker, aber er ist gleichzeitig sehr klar in seinen Einschätzungen. Er denkt sehr logisch und praktisch. Aber wenn er über seine künftigen Pläne spricht, ist er sehr enigmatisch: Er sagt nicht klar, welche Methoden er in Zukunft anwenden wird. Er tut das, um sich nicht in die Karten blicken zu lassen.
Und trotzdem sind Sie entspannt, wenn Sie auf seine zweite Präsidentschaft blicken?
Ja. Wir kennen uns, wir sind uns schon oft persönlich begegnet und haben uns ausführlich unterhalten. Er kam 2017, während seiner ersten Präsidentschaft, nach Polen und später habe ich ihn dreimal im Weißen Haus besucht. Im April dieses Jahres hatten wir ein längeres Gespräch in New York. Ich kann sagen, dass ich ganz beruhigt darauf warte, bis er wieder im Amt ist. Ich glaube, es gibt nur zwei Präsidenten auf der Welt, vor denen Wladimir Putin wirklich Angst hat: der chinesische Präsident Xi Jinping und Donald Trump.
Warum?
Weil Donald Trump ein starker Mann ist. Er kann Entscheidungen treffen – und hat in seinem Leben schon viele wichtige getroffen. Oft wurden in deren Folge große Investitionen getätigt. Er hat große ökonomische Erfahrung. Und für Wladimir Putin sind seine künftigen Entscheidungen nicht abzuschätzen.
Wenn alle Mitgliedstaaten der EU vier Prozent des BIP aufwenden würden, dann könnten wir uns vielleicht selbst ohne die USA gegen Russland verteidigen
Sie glauben also nicht, dass Trump die Ukraine im Stich lässt – wie das viele in Europa befürchten?
Präsident Trump zählt und rechnet. Er weiß sehr wohl, wie viel die USA in die Ukraine politisch investiert haben, während seiner letzten Präsidentschaft, aber auch in den vergangenen vier Jahren. Ich glaube nicht, dass er solche Investitionen einfach so aufgeben wird. Wenn meine Amtskollegen im Gespräch Befürchtungen äußern, was Trump in der Ukraine machen wird, lächle ich und sage: Versucht mal, Trump etwas wegzunehmen, was er als sein Interesse sieht.
Donald Trump hat auch angedeutet, dass er sich aus der NATO zurückziehen könnte. Für Polen ist die NATO besonders wichtig. Sind Sie diesbezüglich auch so entspannt?
Man muss den Zeitpunkt und die Hintergründe für Donald Trumps Aussagen anschauen und sich vergegenwärtigen, wie er auf die Welt schaut. Sein ganzes Leben lang hat er Geschäfte gemacht. Wenn er jetzt wieder das Präsidentenamt übernimmt, dann stehen für ihn die amerikanischen Interessen bzw. jene der amerikanischen Steuerzahler im Vordergrund. Gleichzeitig will er sicherstellen, dass die USA eine gewichtige Weltmacht bleiben – und das können sie nur, wenn sie reich sind. Jedes Fass hat einen Boden. Deshalb will Trump, dass jeder für seine Sicherheit und Verteidigung zahlt.
Sie meinen also, dass Trumps Drohung nur dazu da ist, die Europäer dazu zu bringen, endlich mehr in ihre Verteidigung zu investieren?
Wenn Donald Trump vom Austritt aus der NATO spricht, dann meint er, dass er nicht die Kosten für die Verteidigung jener Länder tragen will, die selbst nicht dafür zahlen wollen. Aber es gibt auch noch eine andere Dimension in dieser Frage, und das ist ein Paradox: Jene Länder, die keine zwei Prozent für ihre Verteidigung aufwenden, treten für europäische Autonomie ein. Ich möchte ja wissen, wie Europa sich so verteidigen soll.
Sie sprechen von Deutschland und Frankreich?
Ich sage es so: Wenn alle Mitgliedstaaten der EU vier Prozent des BIP aufwenden würden – einen Wert, den Polen in diesem Jahr sogar übertroffen hat –, dann könnten wir uns vielleicht selbst ohne die USA gegen Russland verteidigen. Mit nur zwei Prozent des BIP haben wir keine Chance.
Wir sind in Zeiten wie im Kalten Krieg
Wie lautet Ihr Argument, um Ihre europäischen Kollegen zu überzeugen?
Wir sind in Zeiten wie im Kalten Krieg. Russland führt heute wieder aggressive, imperialistische Politik. Wie damals droht uns Russland mit Atomwaffen. Westeuropa, angeführt von den USA, hat den Kalten Krieg gewonnen und die damalige UdSSR besiegt, ohne einen einzigen Schuss abzufeuern. Sowjet-Russland war nicht in der Lage, den Wettbewerb im Kalten Krieg wirtschaftlich zu gewinnen. Damals haben alle NATO-Staaten mindestens 3 Prozent des BIP für die Verteidigung ausgegeben. Wenn wir die Sicherheitsfragen ernst nehmen und Russland stoppen wollen, müssen wir dahin zurück. Und genau dies habe ich Joe Biden zum 25. Jahrestag der NATO in Washington vorgeschlagen.
Das heißt also, Sie machen sich keine grundsätzlichen Sorgen um die NATO?
Nein. Aber ich glaube, dass die NATO lebendig bleiben muss. Sie muss nicht nur dynamisch reagieren, sondern auch die Handlungen ihrer Gegner antizipieren. Russland lässt nicht nur seine Muskeln spielen, sondern es bedroht Europa auch mit Aggression. Aber dann muss Russland spüren, dass die NATO eine eiserne Faust hat und es ein sehr schlechtes Ende für ihn nehmen wird. Deswegen sollte die NATO sich an die Umstände anpassen: nicht nur durch größere Verteidigungsausgaben, sondern auch die Ausarbeitung von Verteidigungsplänen, gegenseitige Abstimmung der Waffenproduktion, mehr militärische Manöver und Ausbau der Infrastruktur.
Dieses Interview ist in abgeänderter Form zuerst in der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ, www.nzz.ch) erschienen.

 De Maart
De Maart






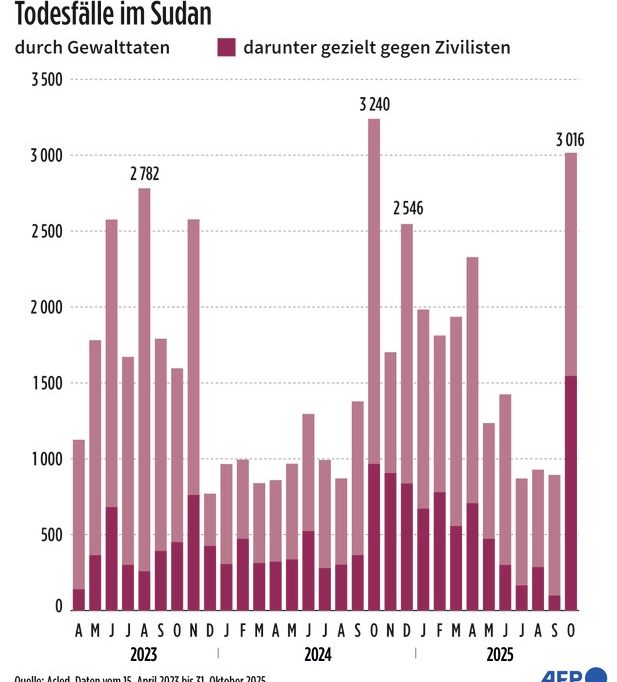
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können