Weihnachten naht. Der Schulbetrieb macht Ferien, das öffentliche Leben dreht langsamer, viele Wohlstandsbürger gehen in Urlaub, ob in die Berge oder an sonnige Strände, andere Zeitgenossen nutzen die Ruhe fern vom stressigen Alltag, um zu lesen.
Monas Augen
In 32 Sprachen übersetzt drängt sich in diesem Jahr das lehrreiche und doch populäre Buch „Les yeux de Mona“ von Thomas Schlesser auf, dies umso mehr, da vor Wochen die deutsche Fassung auf den Markt gekommen ist. In der Spiegel-Bestseller-Liste „Belletristik“ ist „Monas Augen – eine Reise zu den schönsten Kunstwerken unserer Zeit“ von Platz 18 auf 15 vorgerückt. Das Magazin Focus reiht das Werk in die Titelstory „Die schönsten Seiten des Lebens“ (50 Bücher zum Verschenken und Lesen) ein und meint dazu: „Lesen, das heißt, die Welt mit anderen Augen zu sehen.“
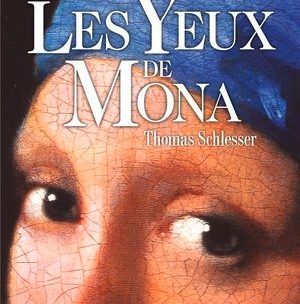
Mit „anderen Augen“ oder, besser noch, zwölf Monate lang mit „eigenen Augen“ kann die kleine Mona, die in einem Jahr ihr Augenlicht völlig verlieren soll, bedeutende Kunstwerke erfassen. Um dies zu ermöglichen, führt ihr Großvater Henry die zehnjährige Mona statt zu einem Psychiater einmal wöchentlich in eines der drei Pariser Museen Le Louvre, d‘Orsay und Centre Pompidou. Hier entdecken beide die großen Meister vergangener Jahrhunderte, etwa Botticelli, da Vinci, Vermeer, Poussin, Friedrich oder auch Manet, Monet, Degas, Cezanne, Van Gogh und Klimt sowie anerkannte Künstler neuerer Zeit von Kandinsky, Duchamp, Malewitch, Magritte und Picasso bis hin zu Pollock, Hartung, Basquiat, Nikki de Saint Phalle, Louise Bourgeois und Marina Abramovic. Focus-Grafikerin Heike Noffke rundet ihr kurzes Statement mit den Worten ab: „Mit jedem Leonardo, Botticelli und Kandinsky entdeckt Mona eine neue Weisheit – und dringt dabei zum Grund ihres Lebens vor.“
Das Buch haben wir Anfang des Jahres eingehend vorgestellt. Thomas Schlesser gelingt es, auf ansprechend erzählerische und doch kunsthistorisch fundierte Weise in 52 Etappen verborgene und offensichtliche Schönheiten der gesichteten Werke herauszulesen, sodass Opa Henry für die junge Mona zum „Leuchtturm in einer neuen Lebensphilosophie“ wird. Hier wird eine faszinierende Erlebnisreise durch die Welt der bildenden Kunst auf ansehnliche Art geschildert. Ein Buch zum Schenken, ob in der französischen Originalfassung oder der deutschen Übersetzung.
Vom Porträt über das Selbstporträt zum „Selfie“
„D’Gesiichter vum Joseph Kutter“ (Nationalmusée um Fëschmaart), die Eigenporträts von Jean-Pierre Beckius (Villa Vauban), jeweils Werke aus früheren Zeiten, oder die aktuellen Selbstporträts von Marc Henri Reckinger (Nationalmusée und Galerien in Düdelingen) sind alles Bilder klassischer Malweise. Kunstpreisträger Reckinger ist darüber hinaus ein für seine Vorliebe zur Selbstdarstellung bekannter Künstler, dies nicht aus Eitelkeit, sondern als Ausdruck innerer Stimmung und sozialer Position des Künstlers, der in einer von Missständen und Ungerechtigkeiten geprägten Welt dieser Gesellschaft gerne den Spiegel vorgehalten hat.

Der Autor und bei uns nicht unbekannte Kunstwissenschaftler Wolfgang Ullrich hat in der Reihe „Digitale Bildkulturen“ des Wagenbach-Verlags bereits 2019 den Band „Selfies“ herausgegeben. Auf knapp 80 Seiten geht er den neuerdings mithilfe digitaler Mittel realisierten Selbstporträts, der Modeerscheinung „Selfie“, auf den Grund.
„Wer ein Selfie macht, macht sich selbst zum Bild. Das ist etwas anderes, als nur ein Bild von sich selbst – ein Selbstporträt – zu machen. Ein Selfie zu machen heißt, ein Bild von sich zu machen, auf dem man sich selbst zum Bild gemacht hat.“ Mit dieser Feststellung, die er in der Folge jedoch nuanciert, leitet er seine Überlegungen zum Thema „Selfies“ ein.
In 17 Kapiteln beleuchtet er unterschiedliche Praktiken und Interpretationen des Phänomens „Selfie“, fragt nach den tiefen Beweggründen, die Menschen dazu bringen, „sich selbst zum Bild zu machen“, sagt, mit der „Selfie-Kultur“ komme zugleich „eine Form von öffentlichem Leben zurück“, blickt in geschichtliche Entwicklungen rund um den menschlichen Körper in der Kunst zurück, und analysiert den Stellenwert diverser Ausdrucksformen, um zu schlussfolgern: „Als Millionen über Millionen weltweit damit anfingen, sich selbst zum Bild zu machen, begann nicht weniger als eine neue Phase der Kulturgeschichte.“ In dieser Etappe leben wir, es gilt diese zu meistern, doch die nächste Herausforderung wartet bereits!
Obiges Büchlein von Wolfgang Ullrich, den wir unter anderem durch Werke wie „Siegerkunst: Neuer Adel, teure Lust“ oder „Bilder auf Weltreise: Eine Globalisierungskritik“ kennen, ist im Shop des „Casino Luxembourg – Forum d‘art contemporain“ zu haben.
Schafft KI die Kreativität des Künstlers ab?
Anlässlich der erfolgreichen zehnten Auflage der Luxembourg Art Week (LAW) stand neben zahlreichen anderen Problemstellungen in Sachen Kunst auch das Thema „Künstliche Intelligenz“ im Fokus eines Rundtischgesprächs. In mittlerweile zahlreichen Büchern wird mehr oder weniger „intelligent“ die Frage nach dem Einfluss der KI auf Produktionsprozesse, Gesundheitswesen, Schulbetrieb, Sicherheitsfragen und natürlich auch Kultur, Kunst und Kreativität der Künstler aufgeworfen.
In einem 2023 herausgegebenen Reclam-Heft hat die Professorin für Philosophie an der Universität Göttingen Catrin Misselhorn ein 150 Seiten starkes Opus, „Künstliche Intelligenz-das Ende der Kunst?“, publiziert. Es ist eine analytische Schrift, in der sie den Versuch unternimmt, auszuloten, was Künstliche Intelligenz auch für den Bereich Kunst bedeutet. Der Begriff ist hier allerdings breit ausgelegt, sodass es nicht nur um bildende Kunst geht.

Eingangs ihrer Überlegungen weist sie unter anderem auf folgende Feststellung hin: „Eine dieser Tätigkeiten (,die wir als intrinsisch wertvoll und erfüllend erleben‘), die in einem besonderen Sinn zum Menschsein gehören und Menschen gegenüber anderen Lebewesen auszeichnen, ist es, Kunst zu schaffen und zu erleben.“ Ist diese infrage gestellt, wenn KI „in sie eindringt“, wie die Autorin moniert. Die Autorin definiert KI und sagt, um was es bei KI geht, d.h. „um die Simulation oder Nachbildung menschlichen künstlerischen Schaffens und künstlerischer Kreativität“. Lange Zeit als unmöglich betrachtet, scheint diese durch die „generative KI“ nun doch Wirklichkeit geworden zu sein. Dies bedeute aber nicht das „Ende der Kunst“, auch wenn KI Kunstwerke erschaffen kann, jedoch nicht „über Bewusstsein“ verfügt oder „denken kann“. Das Buch geht dieser Fragestellung „vor dem Hintergrund der philosophischen Ästhetik“ nach. In fünf Kapiteln nimmt die Autorin unterschiedliche Aspekte unter die Lupe, um am Ende ausführlich und ausschweifend die Kardinalfrage „Ist KI das Ende der Kunst?“ in drei möglichen Szenarien aufzulösen. Das Werk bleibt spannend bis zum letzten Punkt.
Ein anspruchsvolles Buch, das für kreative Künstler, Kultur-Insider und politische Entscheidungsträger interessant ist. Im Handel erhältlich!

 De Maart
De Maart
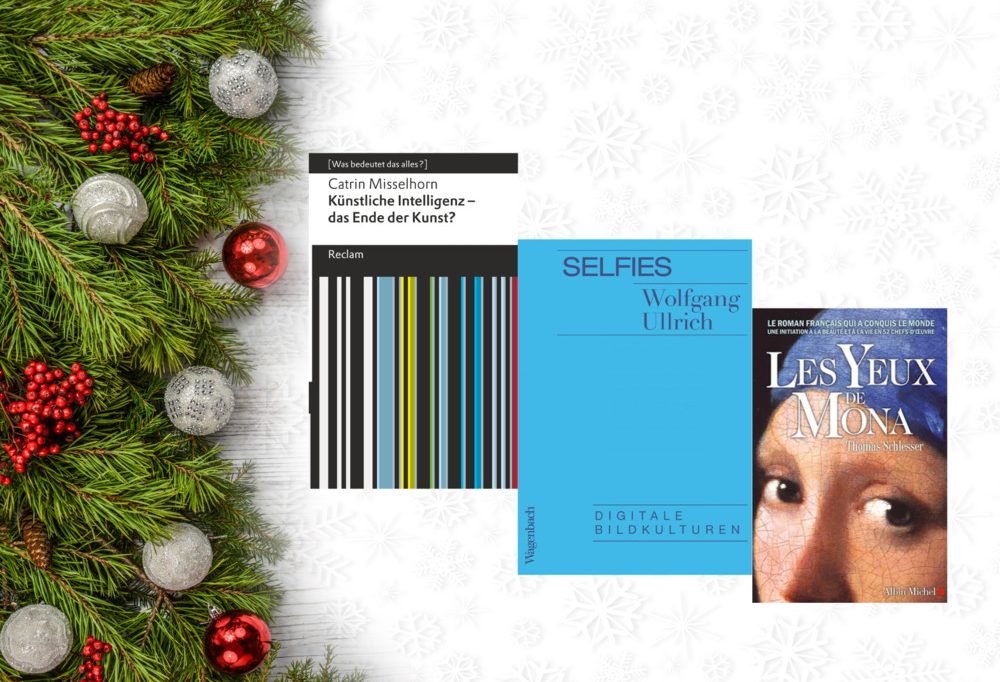






Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können