Eine Runde honoriger chinesischer Professoren diskutierte die möglichen Auswirkungen der Wahl Trumps auf die Beziehungen zwischen China und den USA. Tenor der Diskussion war: Trump möge zwar ein schlechter Businessman gewesen sein, doch als Geschäftsmann sei er immer gut für einen „Deal“.
Die Folge zeigte, dass Trumps Slogan „America First“ effektiv so gemeint war. Für den neuen Präsidenten zählten einzig und allein die amerikanischen Interessen. Wenigstens das, was Trump in seiner engen Weltsicht als die ureigensten Interessen der Vereinigten Staaten ansieht.
Zu seinen ersten Amtshandlungen gehörte der Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen. Er torpedierte die mühsam ausgehandelten Kontrollen der Internationalen Atom-Energie-Behörde über das Nuklear-Programm des Iran. Oder das von Barack Obama mit allen wichtigen Handelsnationen im pazifischen Raum geplante Freihandelsabkommen. Ohne China. Letzteres kam dennoch zustande. Mit China. Doch ohne die USA.
Die ersten vier Trump-Jahre wurden zu ruppigen Zeiten für Trumps „Feinde“ wie „Freunde“. Wobei für Donald Trump Begriffe wie Freund oder Feind beliebig austauschbar sind. Er kokettierte viel mit seinem „Buddy“ Putin. Veranstaltete gar „friedliche“ Shows mit dem nordkoreanischen Diktator Kim. Setzte Mexiko und Kanada unter Druck, um ihnen Konzessionen im binnenamerikanischen Handel abzuringen. Belegte die Europäer mit Strafzöllen. Startete einen Handelskrieg mit China.
Für seinen Busenfreund Netanjahu ließ er gegen geltendes Völkerrecht die US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Als Bruder im Geist und als Vorgriff auf die Wiederwahl Trumps entließ Freund Netanjahu am US-Wahltag seinen Verteidigungsminister Yoav Gallant. Das einzige israelische Regierungsmitglied, das noch Glaubwürdigkeit beim Biden-Team besaß.
Die NATO war in Präsident Trumps Augen nur ein Mittel, um die „Alliierten“ zu höheren Verteidigungsausgaben anzuhalten. Selbstverständlich durch Einkäufe bei der amerikanischen Rüstungsindustrie, ohnehin der weltweit größte Waffenexporteur. Immerhin wurden bislang 70% aller militärischen Hilfen der Europäer an die Ukraine an die USA bezahlt.
Quo vadis Ukraine?
Wie der Zufall es so will, entstand dieser Artikel wiederum während eines China-Aufenthaltes. Diesmal nicht in der Hauptstadt Beijing, sondern in tiefster chinesischer Provinz. Die Nachricht von Trumps Wiederwahl wurde mit der üblichen chinesischen Vorsicht aufgenommen. Man will sich nicht in die „inneren Angelegenheiten“ eines anderen Staates einmischen. Dennoch war die häufigste Frage: „Wie geht es jetzt weiter mit dem Krieg in der Ukraine? Wird Trump diesen beenden?“
Bei internationalen Gelegenheiten, wie kürzlich bei dem Brics+-Treffen in Kasan, beteuert Chinas Präsident Xi seine Freundschaft mit Wladimir Putin. Doch bleibt in Chinas Augen der russische Einfall in die Ukraine ein störendes Element im internationalen Handel, der vordringlichsten Ambition der Volksrepublik. Die jedes Mal, wenn Putin mit atomaren Schlägen drohte, sich eindeutig gegen den Einsatz von Nuklearwaffen aussprach.
Im Wahlkampf tönte Trump, er würde den Krieg in der Ukraine binnen weniger Tage beenden. Ob er es schafft, die nordkoreanischen Söldner seines Freundes Kim wieder nach Hause zu schicken, darf angezweifelt werden. Kann er Selenskyj zu einer Kapitulation zwingen? Schwierig. Im Vorfeld der Wahlen verkündigte ein Mitstreiter Trumps, ehemaliger Sicherheitsberater der USA, ein Präsident Trump würde die Ukraine nicht fallen lassen. Doch müssten allein die Europäer für die Waffenhilfe an die Ukraine aufkommen.
Bis Trump und sein neues Team Anfang Januar die Regierungsgeschäfte übernehmen, darf gerätselt werden. Sicher ist jedenfalls, dass Trump dieses Mal besser vorbereitet antritt und eine Mannschaft von Gleichgesinnten um sich schart. Großmäulig wie immer kündigte der selbsternannte „Macher“ an, gleich am ersten Amtstag würde er so viele „Executive Orders“ unterzeichnen, wie noch kein Präsident vor ihm.
Die Finanzwelt jubelt
Was erklärt, weshalb die Welt der Spekulanten den sich anbahnenden Trump-Sieg mit einem Freudenfeuer auf den US-Börsen, dem Dollar- oder dem Bitcoin-Kurs begrüßte. Besonders die Aktien von Erdölfirmen sowie von Zulieferanten der Öl- und Gas-Industrie erzielten starke Zugewinne. Trump wird mit Sicherheit neue Permits für die Förderung von Erdöl und Gas erteilen. Was erklärt, weshalb die Preise für Öl bereits nachgaben.
Keine gute Nachricht für den COP-Wanderzirkus, der am 11. November in Baku den definitiven Ausstieg aus karbonhaltigen Treibstoffen einleiten soll. Immerhin sind die USA seit sechs Jahren der weltweit größte Förderer von Rohöl. Gleichzeitig verkaufen sie den Europäern massiv verflüssigtes Erdgas. Das viel teurer ist als das russische Erdgas, dem sich die EU-Europäer aus Solidarität mit der Ukraine entwöhnen mussten.
Die Weltwirtschaft steuert ohnehin auf eine Ölschwemme zu. Neben dem OPEC-Kartell bauen neue Ölländer wie Brasilien, Guyana, Senegal, aber auch Kanada und die USA ihre Förderung stark aus. Laut Weltbank ist im kommenden Jahr mit einem Überangebot von 1,2 bis 2 Millionen Fass (jeweils 159 Liter) täglich zu rechnen.
Besonders die Nachfrage aus China stagniert. Das Riesenland geriet zwar zur weltweiten Nummer eins beim Ausstoß von CO2. Doch praktizieren die Chinesen letztlich eine vernünftigere Umweltpolitik als die Amerikaner und die Europäer. Letztere wollen mit Verboten und Illusionen eine Vorreiterrolle vorgeben, die ihnen niemand abkauft.
Wer durch Chinas entlegenste Provinzen fährt, sieht überall Photovoltaik und Windkraft am Werk. Mit einer Technologie, welche billiger und besser ist als diejenige der Europäer. Gleichzeitig bauen die Chinesen massiv CO2-freie Kernkraftwerke sowie modernste Kohlekraftwerke mit CO2-Abscheidung.
Nirgendwo sonst sieht man so viele Elektroautos wie auf Chinas Straßen. Tesla, BMW, VW, Toyota und andere Weltfirmen lassen in China E-Autos fertigen. Haben jetzt Absatzschwierigkeiten, weil chinesische Konstrukteure immer bessere E-Autos bauen. Ich besuchte bei der Stadt Ningbo ein Geely-Werk, wo tausende Roboter täglich mehrere hundert sehr luxuriöse E-Autos zusammenbauen. Bloß 300 Arbeiter überwachen hauptsächlich die Qualität. Da helfen auf die Dauer keine Strafzölle, die auch europäische oder amerikanische Konstrukteure in China treffen.
Dennoch verbietet China nicht den Verbrennungsmotor. Noch träumt es wie die Europäer von E-Lastkraftwagen, angetrieben durch sechs Tonnen schwere Batterien. Oder durch Wasserstoff, das zu einem halbwegs vernünftigen Preis nur über Diesel-Generatoren herzustellen wäre. Dagegen rüstet China seine riesige Lastwagenflotte um auf Flüssiggas-Antrieb. Somit sparen sie Rohöl ein. Das Gas liefern die Russen, wegen europäischer Sanktionen unter dem Weltmarktpreis.
Europäische Illusionen
Die kommenden Jahre sehen das Aufleben des bornierten Nationalismus. Weshalb ein Trump gerade von den europäischen Rechtsextremen gefeiert wird. Die sogenannte „Weltordnung“ wird getrieben durch eigennützige Machtpolitik. Die Eigeninteressen kommen vor dem moralistischen Gehabe der Europäer. Deren Gutmensch-Predigten über Klimaschutz, Biodiversität und Lieferketten-Gesetze nur Gehör finden, wenn der „reiche Westen“ dem „globalen Süden“ zur Sühne Geld bietet.
Gefragt ist eine europäische „Realpolitik“. Auf die USA eines Trump wird Europa immer weniger zählen können. Russland bleibt ein gleichfalls unberechenbarer und damit gefährlicher Nachbar.
China, Indien und viele andere aufstrebende Nationen suchen ihre wirtschaftlichen Vorteile. Europa hat ebenfalls viel zu exportieren. Benötigt deshalb zusätzliche Handelsabkommen. Was immer Geben und Nehmen bedeutet. Wie beim Mercosur-Vertrag. Wie bei unseren Beziehungen mit China.
Gerade wir Europäer, ohne allzu viele Rohstoffe, mit alternden Technologien und Angst vor allem Neuen, ob Genetik oder künstlicher Intelligenz, müssen die Welt nehmen, wie sie ist, nicht wie man sie erträumen könnte.
Das erfordert Risikobereitschaft, auch gegenüber „angestammten Rechten“, „Renaturierung“ und anderen grünen Träumen. Sowie die Bereitschaft zu Investitionen in eine eigenständige Energiepolitik, eine gemeinsame Rüstungsindustrie, finanziert durch Eurobonds. Was Europa einen ebenso liquiden Finanzmarkt bescheren würde, wie derjenige in Übersee. Der nunmehr Heiland Trump feiert.


 De Maart
De Maart





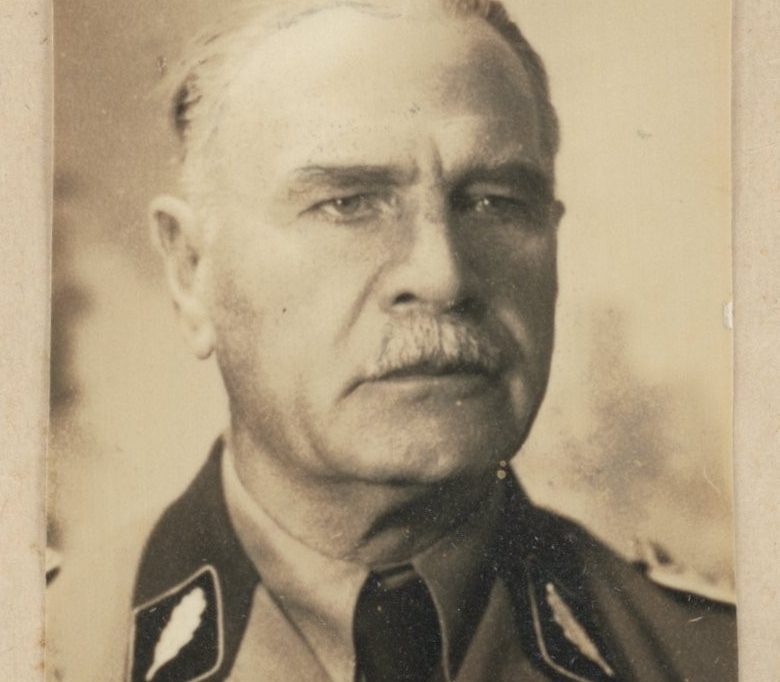

Vor 8 Jahren war er ja auch schon als Heiland aufgetreten. Was hat es dem "normalen" Bürger gebracht?