Der Park ist angelegt, der Aufzug in Betrieb, die Rollstuhlrampen befahrbar und der Sichtschutz zum Stahlwerk steht schon länger: Das „Vëlodukt“ ist 22 Monate nach seiner Eröffnung endgültig fertig. Die längste Radbrücke Europas wurde in einer Rekordzeit von 16 Monaten gebaut und kostete ebenfalls rekordverdächtige 32 Millionen Euro allein für die Brückenkonstruktion. Zusammen mit den Arbeiten in der Peripherie belief sich das Budget für das spektakuläre Bauwerk zwischen Esch und Belval auf 47,5 Millionen Euro.
Was den Fußgängern nach der Eröffnung des „Vëlodukt“ zwischen Esch und Belval sofort auffiel, waren die Schwingungen der Brücke. Bei dem ein oder anderen hinterließen sie ein flaues Gefühl in der Magengrube. Völlig normal, sagen Fritz De Oliveira und Laurent Didier von der Straßenbauverwaltung und erklären, was es damit auf sich hat: „Es ist keine Frage der Sicherheit, die ist durch die Statik der Konstruktion eh gewährleistet. Um es einfach auszudrücken: Es gibt zwei Arten von Brücken, leichte und schwere. Das ‚Vëlodukt‘ ist eine leichte Brücke und da spielt nicht nur die Statik, sondern die Dynamik eine wichtige Rolle“, sagt Fritz De Oliveira, Chef der „Division des ouvrages d’art“ bei den „Ponts et chaussées“. Es geht um den Komfort des Nutzers: „Weil die Brücke leicht ist, muss man die Dynamik untersuchen. Das haben wir während des Kulturlaufs 2023 getan, und mit dem Personal der Gemeinde, als wir Tests mit 200 Menschen auf der Brücke durchführten. Dabei wurde geprüft, ob die Brücke vibriert und wenn ja, ob die Vibration noch in einem komfortablen Bereich liegt“, so De Oliveira weiter.

Test als Standardprozedur
Bei den Tests mit dem Gemeindepersonal wurden sämtliche Szenarien durchgespielt. Zum Beispiel Menschen, die zeitgleich springen. So bekam man Erkenntnisse darüber, wie sich die Brücke in welcher Situation verhält. Es handelt sich dabei um eine Standardprozedur, die bei jeder Brücke durchgeführt wird. Beim „Vëlodukt“ war das umso spektakulärer, weil durch ihre Länge viele Testpersonen benötigt wurden. In der Praxis wird also geprüft, ob die Berechnungen des Ingenieurs, der die Brücke in der Theorie entworfen hat, stimmen. Dazu gehört auch, wie sie schwingt. „Die Leute sollen sich schließlich auf der Brücke wohlfühlen“, ergänzt Ex-Radprofi Laurent Didier, der bei der Straßenbauverwaltung für das „Vëlodukt“ verantwortlich ist.
Es kann durchaus nachjustiert werden, denn in der Brücke sind insgesamt vier Dämpfer unter den gelben Trägern eingebaut. Es ist also auch eine Sache der Einstellung, weshalb bis jetzt jährlich ein Monitoring durch eine spezialisierte Firma aus Deutschland durchgeführt wurde. Zuletzt war das im Mai der Fall. „Da wurden Tests mit einem Shaker gemacht, um zu schauen, wie die Brücke antwortet. Der Shaker simuliert die Schwingungen“, erzählt Didier. Jetzt, da alle Arbeiten abgeschlossen und alle Tests durchgeführt sind, kümmern sich die Experten der Straßenbauverwaltung um die Überwachung des „Vëlodukt“, alle drei Jahre ist große Inspektion.
Eine Brücke ist nicht wie Wein, mit dem Alter wird sie schlechter. Wobei schlecht nicht automatisch kaputt heißt.
Auch das ist eine Standardprozedur bei Brücken in Luxemburg, wie Fritz De Oliveira erklärt: „Eine Brücke ist nicht wie Wein, mit dem Alter wird sie schlechter. Wobei schlecht nicht automatisch kaputt heißt. Brücken sind prinzipiell auf eine Lebensdauer von 100 Jahren ausgelegt, das ist eine europäische Norm. Diese 100 Jahre sind aber natürlich gebunden an einen Unterhalt. Beim ‚Vëlodukt‘ ist der nicht so kompliziert wie bei Autobrücken, weil auf der Passerelle lediglich Fahrräder und Fußgänger unterwegs sind. Autobrücken werden für eine gewisse Last dimensioniert, die sich mit der Zeit aber dramatisch verändert hat. V.a. durch die Zunahme des LKW-Verkehrs. Ein Lastwagen sind 10.000 Autos. Deshalb haben wir ein Unterhaltsprogramm für die Brücken, und das ‚Vëlodukt‘ gehört dazu.“
Fünf Tonnen pro Quadratmeter
Es ist also eine Frage der Belastung und des Unterhalts, wenn Brücken wie in diesem Jahr in Dresden (D) oder 2018 in Genua (I) plötzlich einstürzen. Und das „Vëlodukt“? Was ist, wenn eine Social-Media-Community plötzlich dazu aufruft, nach einem Konzert in der Rockhal zu Tausenden die Brücke zu stürmen? „Sie ist mit 7,5 Tonnen stärker dimensioniert als eine normale Radbrücke. Das entspricht 500 Kilogramm pro Quadratmeter“, sagt De Oliveira. In anderen Worten: So viele Menschen bekommt man gar nicht auf das „Vëlodukt“, um es zum Einstürzen zu bringen. Der Grund, weshalb es für 7,5 anstelle der üblichen 3,5 Tonnen dimensioniert wurde, sind die Rettungsdienste. Laurent Didier: „Bei einem Notfall in der Mitte der Brücke kann man nicht mit der Bahre kommen, dafür ist sie mit 800 Metern zu lang. Also wurde sie für die schweren Rettungswagen des CGDIS dimensioniert.“
Das, beschwichtigt De Oliveira, sei allerdings nicht der Grund, weshalb der Bau des „Vëlodukt“ vergleichsweise teuer war. Die stärkere Dimensionierung trägt nicht unbedingt zu höheren Kosten bei: „Eine kleinere Brücke wird nicht proportional billiger als eine große. Es wäre lediglich ein wenig an Material gespart worden.“ Die Herausforderung beim Bau war nicht das Material, sondern in erster Linie die Logistik, da die Brücke auf dem Grundstück von ArcelorMittal liegt und die Produktion dort nicht gestört werden durfte. Vor allem, weil der Zeitplan sehr ambitioniert war. „Soviel Stahl in so kurzer Zeit zusammenzubauen, das können europaweit nur fünf Firmen. Schlussendlich war es ein italienisches Unternehmen, der den Stahl aus Differdingen verarbeitet hat“, berichtet De Oliveira. Das sei auch der Grund, weshalb man Cortenstahl verwendet hätte, ergänzt Didier, denn der ist wetterfest und wartungsfrei. Er muss vor allen Dingen nicht angestrichen werden. Ein Anstrich kann je nach Witterungsbedingungen viel Zeit in Anspruch nehmen.


 De Maart
De Maart





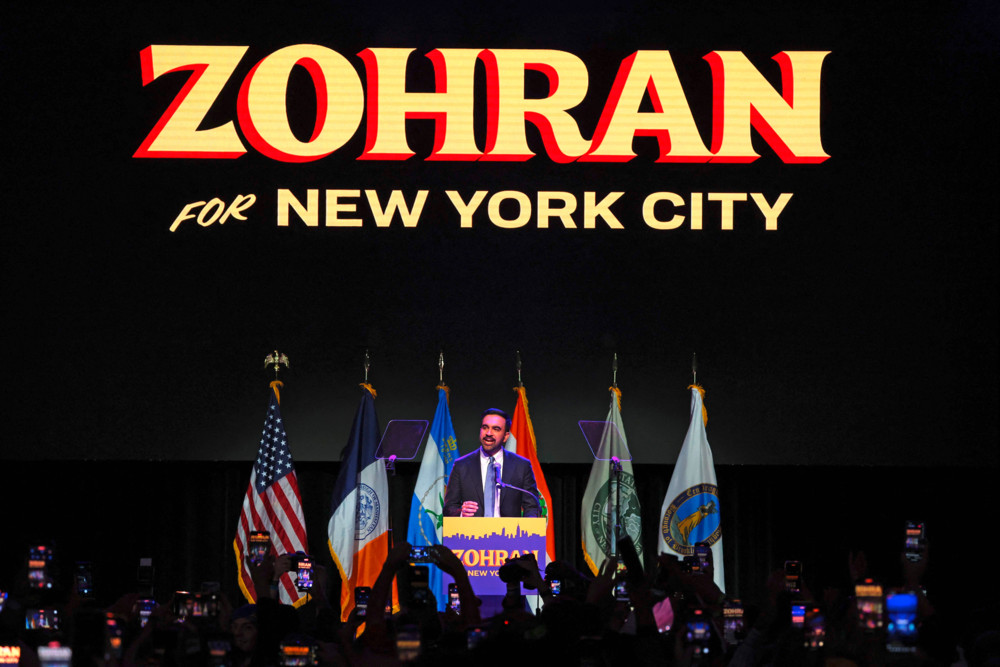



Geschter hat ech 6! Velofuerer baieneen driwerfuren gesin. Duerno Stonnelaang neischt bis een Jogger driwergelaaf ass. Mais EUweit all LU awer top. 🤣🤣🤣
Den Laurent trainéiert do heemlech fir säin Comeback! 😊
@Jemp / D'Jongen aus dem Schmelzer Magaseng froen, déi wëssen Bescheed!
Wenn der Bauträger schon knapp 2 Jahre nach der Inbetriebnahme von "...mit dem Alter wird sie schlechter..." spricht, kann der Steuerzahler nicht gerade auf qualitativ hochwertigen Brückenbau schliessen. Bin gespannt wann das Teil wegen zu hohen Unterhaltskosten wieder abgerissen wird. War sowieso eine von Bausch's begrünte Schnappsidee!
Dölpessen breck........huet vill Steiersuen kascht
Hauptsache lang, die teure Velobrücke! Wird kaum befahren, so wie auch Radwege durch Dörfer und Städte. Die richtigen und harten Velo Freunde begegnet man nie auf Radwegen, nein die fahren auf der Autospur .
@ Jemp / Ich tippe auf einen Durchschnitt von 5 (fünf)
Interessant waere es zu wissen, wieviele Leute pro Tag die Bruecke benutzen. Sind es eher 9, 15 oder sogar 18 ?