„La pire amie du monde“ Alexandra Matine

Cyr, fin de trentaine, Française vivant à Amsterdam, vient de se faire remercier par sa boîte sur un ton doucereux : „Nous, on veut avant tout que tu sois heureuse, te donner des opportunités, t’aider à te découvrir, à explorer ton potentiel.“ La réalité, c’est qu’ils ne veulent plus d’elle depuis qu’ils l’ont aperçue dans un parc alors qu’elle était censée être malade, après avoir appris la mort de son meilleur ami. Mais Cyr ne pleure pas. Pour s’occuper, elle monte des meubles Ikea, et se fait livrer des Uber Eats, „(…) je trouvais rassurant qu’il y ait toujours, dans la ville, un livreur en route vers chez moi“.
Après „Les Grandes Occasions“, son premier roman paru aux éditions Les Avrils en 2021, Alexandra Matine nous offre une nouvelle œuvre plus savoureuse encore, magnifiquement écrite, emplie de mille images, idées et trouvailles que l’on prend plaisir à lire et à relire, à apprendre par cœur, même, tant il est plaisant de plonger dans son univers, et d’imprégner le nôtre ensuite de sa sensibilité si particulière. Ses personnages se livrent à nous sans fard, avec leurs contradictions, leurs failles, leur complexité, dans une écriture poétique, colorée, dotée d’une saisissante sensualité littéraire. Et puis Alexandra Matine a le sens de l’humour. Dès les premières pages, son style enlevé, la façon dont elle parvient à mettre ses personnages dans des situations loufoques pour en tirer un sens profond, loin de l’apitoiement, de la victimisation ou du mélodrame, force l’admiration.
Un régal de récit, et la découverte d’une grande autrice.
(Amélie Vrla)
Alexandra Matine, „La pire amie du monde“, Les Avrils, 336 pages, 22 euros
„Women Without Kids“ de Ruby Warrington

Longtemps journaliste pour la presse féminine à Londres, Ruby Warrington a souvent dû répondre à la question choquée: „Mais pourquoi ne veux-tu pas d’enfants?“ Constatant par ailleurs que le déclin de la natalité dans les pays occidentaux était notamment lié au fait que de plus en plus de personnes renonçaient ou refusaient de devenir parents, elle a voulu comprendre les raisons de ce nouvel essor. Son ouvrage – à la croisée des genres, entre essai sociologique, anthropologique, autobiographique, et développement personnel – dresse un portrait précis et pertinent de la société contemporaine, en prenant compte des problématiques raciales et queer, en confrontant les privilèges et en déconstruisant les idées reçues. Warrington a fait un travail de recherche considérable. Sa pensée est claire, juste et bien construite. Elle utilise sa propre personne et son parcours comme terrain de recherche, se livre dans une honnêteté courageuse et lumineuse, partage les outils qui l’ont aidée, afin de nous offrir de nouvelles et importantes pistes de réflexions. Elle questionne les idées reçues et s’attaque aux tabous pour en tirer une force et un élan, une vision nouvelle et motrice qui nous permettent d’aller de l’avant en tant que société et espèce. Son livre s’interroge sur la notion de famille dysfonctionnelle, sur le sens de la vie et de la procréation, sur la thèse de Gaëlle Sheehy selon laquelle la ménopause est la deuxième vie adulte de la femme, aussi bien que sur la théorie de la „générativité“ d’Erik Erikson. Un livre passionnant, instructif et inspirant sur des questions politiques, philosophiques et sociales de la plus grande importance.
(Amélie Vrla)
Ruby Warrington, „Women without kids“, Sounds True, 240 pages
„Baumgartner“ von Paul Auster

Seit etwa 35 Jahren lese ich die Bücher von Paul Auster. Keinem Schriftsteller bin ich über so lange Zeit treu geblieben. Ich habe mich mit der Vorliebe für seine Bücher selten getäuscht, habe mich von seiner „New York Trilogie“ in den 80er Jahren anstecken lassen, zähle noch heute Romane wie „Musik des Zufalls“ oder „Mond über Manhattan“ zu meinen Lieblingsbüchern, bin ihm sogar über dicke Schinken wie „4321“ gefolgt und war nicht enttäuscht, las Autobiographisches von ihm und Essayistisches – und nun bin ich traurig. Vor einigen Monaten hörte ich, dass der 76-Jährige an Krebs erkrankt sei. Mit den Gedanken an ihn nahm ich seinen neu auf Deutsch übersetzten Roman „Baumgartner“ in die Hand und empfand wieder den Auster-Sog, seine ihm ganz eigene Stimmung und fühle mich wieder wie in den Anfangstagen bei „Stadt aus Glas“. Und doch ist „Baumgartner“ auch ein Buch über die Endlichkeit und das Sterben. Eine Fabel darin heißt „Lebenslänglich“: Ein 17-Jähriger wird von einem Gericht dazu verurteilt, „lebenslänglich Sätze zu machen“. Typisch Auster, dachte ich. Seitdem sitzt der Mann, etwa in Austers Alter, in einer Zelle. In dem Buch heißt es: „Ich bin alt geworden, aber weil die Tage wie im Flug vergangen sind, fühle ich mich im Wesentlichen noch jung, und solange ich einen Stift in der Hand halten und den Satz vor mir noch sehen kann, werde ich wohl weitermachen wie seit dem Morgen, an dem ich hier angekommen bin.“ Wieder steckt viel Auster in dem Roman wie auch in dessen Hauptfigur – und ich kann nur sagen: Auster soll noch lange schreiben müssen. Sein „Baumgartner“, ein Witwer, dreht sich um den Tod von dessen Frau – bis er sich neu verliebt.
(Stefan Kunzmann)
Paul Auster: „Baumgartner“, Rowohlt-Verlag, Hamburg 2023, 208 Seiten, 22 Euro
„Abgrund“ von Pilar Quintana

„Als Kinder sind wir neugierige Entdecker und beobachten etwa Ameisen“, schreibt Pilar Quintana und fügt hinzu: „Aber wir wachen auch in der schrecklichen Welt der Erwachsenen auf.“ In dem Roman „Abgrund“ lebt die achtjährige Claudia mit ihren Eltern in einer Wohnung in der kolumbianischen Millionenstadt Cali. Sie ist die meiste Zeit allein. Nicht mal mit der Hausangestellten darf sie sich anfreunden. Die Wohnung voller Pflanzen beschreibt sie als eine Art Dschungel. Ihre Mutter träumt noch von der großen Liebe und blättert ständig in Zeitschriften, während der 21 Jahre ältere Vater Geschäftsführer in einem Supermarkt ist. Als die Mutter, die übrigens auch Claudia heißt, eine Affäre mit einem schmierigen jungen Mann namens Gonzalo hat, entdeckt dies der Vater. Die Hölle, das sind die anderen, könnte man meinen. Die Mutter beginnt zu trinken und flüchtet sich in Krankheiten, bleibt tagelang im Bett liegen. Vor allem das Verhältnis der Tochter zur Mutter steht im Vordergrund. Einmal sagt das Mädchen zur Haushälterin: „Ich schubse sie die Treppe runter. Dann sage ich ihr die Wahrheit: Dass sie die schlechteste Mama der Welt ist.“ Hoffnung kommt aus dem Urwald. Nach „Die Hündin“ ein weiterer überzeugender Roman der 1972 geborenen kolumbianischen Autorin, flüssig geschrieben und lakonisch im Tonfall, gelungen übersetzt.
(Stefan Kunzmann)
Pilar Quintana: „Abgrund“, Aufbau-Verlag, Berlin 2023, 256 Seiten, 22 Euro
„Ne réveille pas les enfants“ d’Ariane Chemin
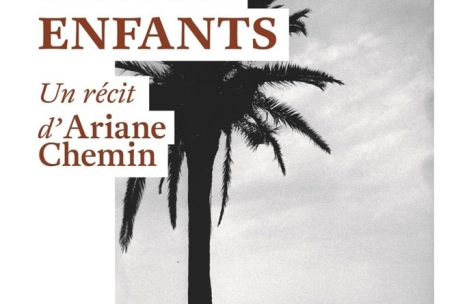
Mis sur la piste par son éditeur, Adrien Bosc, en charge des excellentes éditions du Sous-sol spécialisées dans la non-fiction (des traductions d’œuvres américaines surtout: Gay Talese, récemment David Grann), la journaliste du Monde, Ariane Chemin, enquête sur un fait divers troublant survenu le 24 mars 2022. Ce jour-là, à Montreux en Suisse, une femme, sa sœur jumelle, son mari, sa fille, son fils adolescent sautent les uns après les autres du balcon de l’immeuble cossu dans lequel ils résident. La police était venu frapper à leur porte et ils avaient pensé que c’était là la seule issue pour eux. Pourtant, ils n’avaient quasiment rien à se reprocher, en tout cas rien qui justifie telle extrémité. La justice suisse a clos le dossier, ne s’intéressant pas à connaître les motivations de ce suicide collectif, dans un pays déjà marqué par la tragédie du Temple du soleil. Mais ce n’est pas en 1994 que remonte Ariane Chemin, mais en 1962. Car les deux sœurs jumelles sont les petites-filles de l’écrivain algérien Mouloud Ferraoun, assassiné par l’OAS aux derniers jours de la guerre d’Algérie. C’était l’époque où l’organisation de l’armée secrète faisait des attentats à l’aveugle dans les rues d’Algérie et où leurs jeunes sympathisants à l’école refusaient d’observer une minute de silence pour la mort de l’écrivain. Ariane Chemin enquête sur la cause du suicide et sur les tendances survivalistes de la famille suicidée, mais en allant chercher aussi dans leur passé algérien, elle tisse un lien convaincant entre les deux générations d’une même famille, comme le journalisme l’aurait empêché de le faire, mais comme la littérature lui permet.
(Jérôme Quiqueret)
Ariane Chemin, „Ne réveille pas les enfants“, éditions du Sous-sol, 192 pages, 18,50 euros
„Zierfische in Händen von Idioten“ von Manuel Butt

„Wie schafften die Menschen es bloß, aus dem gewöhnlichsten Obst der Welt etwas so Sensationelles herzustellen wie Apfelshampoo?“ Denkt Tobi, während er an Lisas Haaren schnuppert und auf das erste Mal hofft. Manuel Butts Romanheld ist siebzehn Jahre alt, also in einer Lebensphase angelangt, wo theoretisch alles möglich scheint und praktisch rein gar nichts geht. Er lebt in irgendeinem deutschen Allerweltskaff an der Ostsee. Seine Eltern sind in Urlaub gefahren, und alles, was Tobi zu tun hat, lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Die Fahrprüfung schaffen und die Seepferdchen seines Vaters nicht verhungern lassen. Wir schreiben das Jahr 1996. Es ist Sommer, der Popsong „Whatever“ von Oasis steht hoch im Kurs und Jürgen Klinsmann ist das Idol der Massen. Wirklich alle hoffen darauf, dass Deutschland bei den Fußballeuropameisterschaften triumphieren wird. Quasi im Windschatten des Sportereignisses vollzieht sich sprunghaft das Erwachsenwerden einer Reihe von Jugendlichen. Neben Tobi, den wir nicht gerade als die hellste Kerze auf der Torte bezeichnen können (siehe Eingangszitat) und Lisa wären da vor allem Georg (Lisas bester Freund) und Scholten (wiederum Tobis bester Freund) zu nennen. Im Lauf des Romans „Zierfische in Händen von Idioten“ werden sie anfangs beinahe zufällig zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammengeschweißt – wobei das zeitgenössische Kolorit der Geschichte keineswegs nur Beiwerk ist, sondern entscheidend hilft, die Vergangenheit in ihrer behaupteten Aktualität glaubhaft werden zu lassen.
(Thomas Koppenhagen)
Manuel Butt: „Zierfische in Händen von Idioten“, Verlag Kein und Aber, Zürich 2023, 348 Seiten, 24 Euro
„Saubere Zeiten“ von Andreas Wunn
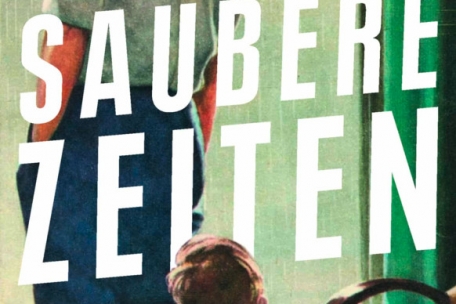
Ein schönes Buchcover zu einem schönen Roman. Hier stimmt endlich einmal die Entsprechung! Man sieht einen Jungen, der wohl seinen Vater, der am Fenster steht, beobachtet. Der Kleine sitzt mit dem Rücken zum Betrachter auf einem Stuhl, wir können also nur mutmaßen, was das Kind denkt und fühlt. Oder halt den Familienroman „Saubere Zeiten“ von Andreas Wunn lesen. Der behandelt, in großem erzählerischen Bogen angelegt, die Rückkehr des Ich-Erzählers, Jacob Auber, in sein Elternhaus in Trier. Der Vater liegt nach einem Schlaganfall sterbend danieder. Nach dessen Tod wird Jacob Tonbandaufnahmen finden, welche die Geschichte der Familie Auber in völlig neuem Licht erscheinen lassen. Der Titel des Romans, „Saubere Zeiten“, fungiert in mehrerer Hinsicht metaphorisch. Zum einen geht es um ein Waschmittel, das Jacobs Großvater erfand und ihn steinreich machte. Zum anderen ist auch das sogenannte Wirtschaftswunder in der Bundesrepublik Deutschland der 1950er Jahre gemeint. Als nämlich eine ganze Gesellschaft versuchte, die Schuld an den ungeheuerlichen Verbrechen, die die Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg verübten, unter allen Umständen zu verdrängen. Das Gewissen sollte nicht nur sauber, sondern rein erscheinen – um den Slogan aus einer Waschmittelwerbung früherer Tage zu paraphrasieren. Andreas Wunn nutzt diese Erzählung aber auch für die Darstellung einer Suche nach Nähe, nach Verständnis, nach Liebe: Die Essenz des Lebens also, und wie sie durch Schweigen zur unerfüllbaren Sehnsucht werden kann.
(Thomas Koppenhagen)
Andreas Wunn: „Saubere Zeiten“, Aufbau-Verlag, Berlin 2023, 381 Seiten, 22 Euro

 De Maart
De Maart





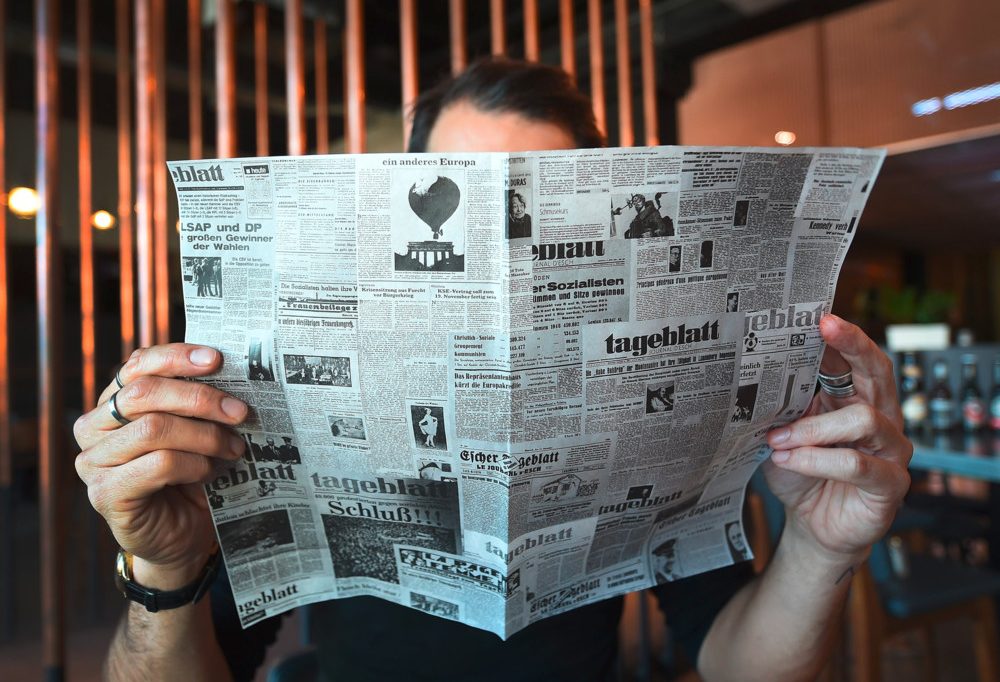

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können