Zunehmende Forderungen aus Afrika und der Karibik nach Reparationen der europäischen Kolonialmächte, die Black-Lives-Matter-Bewegung nach der Ermordung von George Floyd und die Diskussion über langfristige Folgen der Sklaverei hätten der jüngeren Generation einen neuen Blick auf die Hinterlassenschaft des Empire eröffnet. Die Krönung von Charles und Camilla an diesem Samstag komme „zu einem Zeitpunkt, wo so intensiv über das Empire und die Folgen diskutiert wird wie nie zuvor“, sagt Parker.
Sein Buch erscheint im September, genauer gesagt: am 29. September, dem 100. Jahrestag der größten Ausdehnung des britischen Empire. An jenem Tag war 1923 das Völkerbund-Mandat für Großbritannien Gesetz geworden – „man konnte von Kapstadt in Südafrika nach Rangun in Myanmar spazieren“, erläutert Parker, „ohne je britisch-kontrolliertes Territorium zu verlassen“. Ein Viertel der globalen Landmasse wurde von London aus verwaltet. Wenig später begann die Emanzipation der Kolonien und ihre Neuordnung im Commonwealth.
Dem englischsprachigen Club gehören derzeit 56 souveräne Staaten an, darunter auch Länder wie Mosambik, Ruanda oder Togo, die nie Teil des Empire waren. Die Repräsentanten einiger der größten und bevölkerungsreichsten Länder der Welt wie Kanada, Indien und Malaysia treffen dort auf die Kolleginnen von Zwergen wie die Pazifikstaaten Kiribati (60.000 Einwohner) oder Tuvalu (12.000) – besonders für letztere ein wichtiges globales Forum, um beim Treffen der Staats- und Regierungschefs alle zwei Jahre auf eigene Interessen hinzuweisen.
Wenn nicht alles täuscht, stehen dem Commonwealth im kommenden Jahr Turbulenzen ins Haus, wenn es um die Nachfolge der umstrittenen britischen Generalsekretärin Patricia Scotland geht. Noch spannender wird dereinst die Frage, ob nach Charles‘ Tod dessen Sohn William wiederum die Schirmherrschaft übernehmen wird. Dem Vernehmen nach hängt das Herz des Thronfolgers deutlich weniger an dem kuriosen Club als das seines Vaters und vor allem seiner Großmutter, die bei der Evolution des Empire zum Commonwealth dabei war und die Organisation entscheidend prägte.
Wir wollen unsere Geschichte verstehen und uns nicht davor verstecken
Viel unmittelbarer betreffen das Haus Windsor die Aufarbeitung der finsteren Seiten britischer Vergangenheit sowie die Republik-Bewegungen in einigen der 14 Commonwealth-Staaten (neben dem Vereinigten Königreich), deren Staatsoberhaupt Charles III. bisher noch ist. Wäre es schlimm, wenn in nächster Zeit Staaten wie Jamaika oder Australien die Monarchie hinter sich lassen? Nicht furchtbar schlimm, heißt es dazu tapfer im Palast. „Aber natürlich käme es einem Schlag in die Magengrube gleich“, analysiert der Londoner Commonwealth-Spezialist Professor Philip Murphy. Die Loslösung des fünften Kontinents unter seinem republikanisch gesinnten Labour-Premier Anthony Albanese würde den König gewiss schmerzen, zumal Charles mit Australien schöne Kindheitserinnerungen verbindet.
Andrew Holness hat den Wählern auf Jamaika versprochen, was seine barbadische Labour-Kollegin Mia Mottley am Ost-Ende der Karibik bereits erreicht hat: die Loslösung von London. Im Beisein des damaligen Thronfolgers Charles feierte Barbados im November 2021 die Umwandlung zur Republik.
Keine Rede von Reparationen
Dort wie anderswo in der Karibik und Afrika, aber auch auf der britischen Insel werden die Fragen nach der blutigen Vergangenheit des Empire immer lauter. Im Sklavenhandel des 17. und 18. Jahrhunderts spielte die aufstrebende Seemacht England und später Großbritannien dabei eine Schlüsselrolle.
Der Schutz durch die Royal Navy gab der 1660 von König Charles II. mitgegründeten Royal Africa Company exklusive Rechte im Dreieckshandel zwischen England, Afrika und Amerika. Schätzungen sprechen von elf Millionen Schwarzafrikanern, die aus ihrer Heimat verschleppt und als Entrechtete über den Ozean gebracht wurden; viele weitere Millionen starben schon in Afrika oder auf der Reise. Das kaum vorstellbare Unrecht dauerte bis weit ins 19. Jahrhundert hinein.
Seit Jahren verfolgen 15 Länder der karibischen Gemeinschaft (Caricom) Milliarden-Ansprüche gegen die früheren Kolonialmächte, darunter auch Großbritannien. Die Rede ist von Schuldenerlass, mehr Entwicklungshilfe sowie Ausbildung für Lehrer und Ärzte.
Premier Rishi Sunak, als Sohn indisch-stämmiger Einwanderer selbst ein Kind des Empire, hat erst kürzlich jeden Gedanken an Sklaverei-Reparationen von sich gewiesen. Auch der Rückgabe von Kulturgütern an ihre Herkunftsorte steht die konservative Regierung ablehnend gegenüber. „Wir wollen unsere Geschichte verstehen und uns nicht davor verstecken“, sagte der Regierungschef im Unterhaus. Die Labour-Opposition positioniert sich ähnlich: Die „schreckliche Geschichte des Sklavenhandels“ müsse aufgearbeitet werden, von Reparationen könne keine Rede sein.
Sich der eigenen Geschichte stellen
Andere britische Institutionen geben sich offener. Die Universitäten von Cambridge und Glasgow lassen die Verbindungen historischer Gönner zum profitträchtigen transatlantischen Menschenhandel untersuchen. Wie das Guardian-Verlagshaus hat auch die anglikanische Staatskirche „zur Buße für unsere beschämende Vergangenheit“ einen Ausgleichsfonds von 100 Mio. Pfund (113 Mio. Euro) eingerichtet. Allerdings gibt es dagegen innerkirchlichen Widerstand; die Rede ist sogar von einer gerichtlichen Überprüfung. Dem bekannten Empire-Historiker David Olusoga zufolge darf sich Großbritannien nicht länger vor der Erkenntnis drücken, „dass mit geerbtem Reichtum auch Verantwortung einhergeht“.
Für wen würde dies mehr gelten als fürs Königshaus? Noch als Thronfolger hat Charles das koloniale Erbe der Sklaverei, „die auf immer unsere Geschichte beschmutzt“, klar verurteilt; Thronfolger William sprach von „tiefer Reue“ für die „entsetzlichen Gräuel“. Wie offizielle Regierungsvertreter aber unterließen die Royals ausdrücklich eine Entschuldigung im Namen ihres Reiches – aus Furcht vor rechtlichen Folgen.
Immerhin unterstützt das Königshaus nun das Forschungsprojekt einer Doktorandin an der Uni Manchester: Camilla de Koning will die tiefen finanziellen Verstrickungen der Monarchie in den Sklavenhandel zwischen 1660 und 1775 untersuchen. Ergebnisse sind freilich erst 2026 zu erwarten. Mal sehen, ob sich das heikle Thema Ausgleichszahlungen bis dahin auf die lange Bank schieben lässt.

 De Maart
De Maart


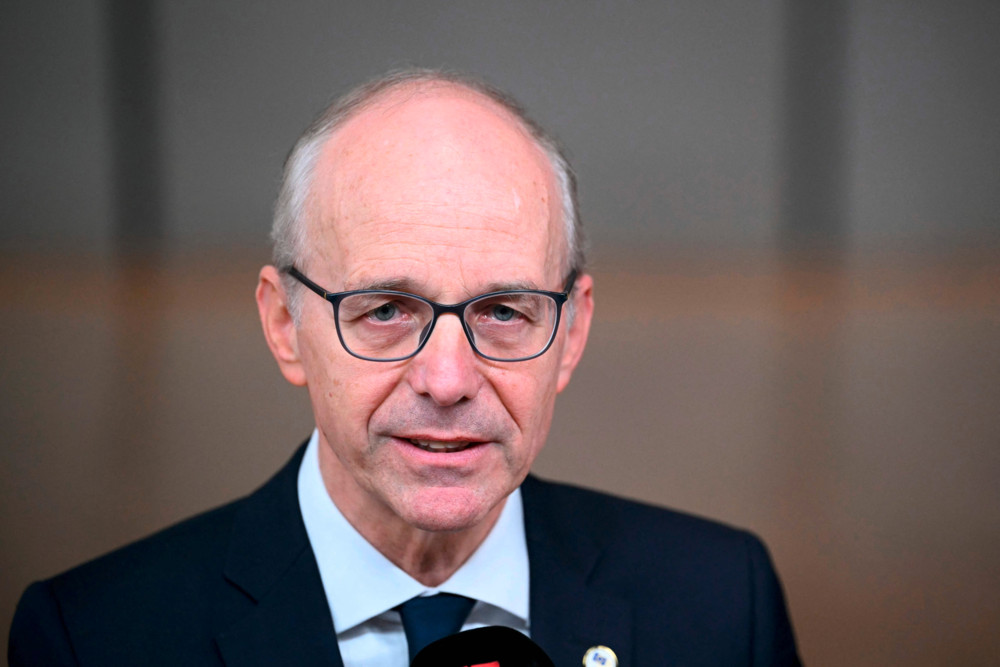

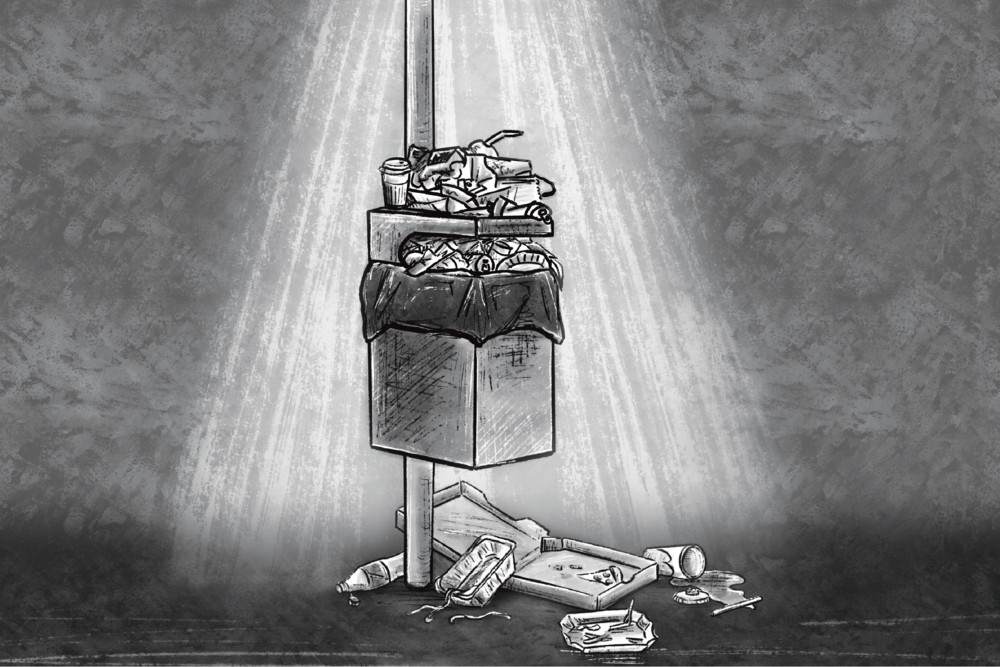


Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können