„So sind wir nicht!“ Gern hörten die Österreicher diese kollektive Exkulpierung, die Bundespräsident Alexander van der Bellen nach dem Platzen des Ibiza-Skandals aussprach. Nur FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und dessen mit ihm auf der Ferieninsel in die Videofalle getappte Adlatus Johann Gudenus sind „so“: korrupt, machtgeil, bar jeder Moral.
Knapp vier Jahre danach wirkt das Bild von der Nation der Saubermänner und -frauen, in der vereinzelte schwarze Schafe nur eine die Regel bestätigende Ausnahme sind, nicht mehr ganz zeitgemäß. Zu weite Kreise haben die Ermittlungen im Gefolge des Megaskandals gezogen. Und vor allem: Zu oft verfangen sich im Netz der euphemistisch „Freunderlwirtschaft“ genannten Korruption auch prominente Repräsentanten der vierten Macht.
Im November schon hatten ORF-Chefredakteur Matthias Schrom und Presse-Chefredakteur Rainer Nowak zurücktreten müssen. Der eine hatte sich in Chats mit Strache intensiv über dessen inhaltlichen und personellen Wünsche an den ORF ausgetauscht, der andere einen dem Generalsekretär des Finanzministeriums Thomas Schmid missfallenden Text auf der Presse-Webseite löschen lassen und ÖVP-Hilfe bei der Realisierung seines Traumes vom ORF-Chefposten erbeten.
Inseratenkorruption
Sichergestellte Chat-Verläufe und Aussagen von Schmid, einem engen Vertrauten von Ex-Kanzler Sebastian Kurz, brachten nun auch die Herausgeber der beiden größten Boulevardzeitungen Österreichs in die Bredouille: das Ehepaar Eva und Christoph Dichand. Sie ist Verlegerin der Gratiszeitung Heute, er Chef der Kronen Zeitung. Gemeinsam war ihnen ein Dorn im Auge, wie das Finanzministerium das Konkurrenzblatt Österreich bei der Vergabe von Inseraten bevorzugte.
Tatsächlich spielte Österreich eine zentrale Rolle bei Kurz‘ Machtübernahme in der ÖVP im Jahr 2017. Nach Aussagen Schmids bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft soll Österreich mit Steuergeld finanzierte Umfragen, die Kurz als Superstar pushten, im Gegenzug für Inserate publiziert haben. Tatsächlich inserierte das Finanzministerium dort 2016 für 411.000 Euro, 90.000 Euro mehr als in der gut dreimal so auflagenstarken Krone. Heute bekam trotz ebenfalls deutlich höherer Auflage nur 161.000 Euro. Was den Dichands auch missfiel, war der Entwurf eines neuen Stiftungsgesetzes, das diese „Geldschränke“ der Reichen etwas transparenter machen sollte. Die Heute-Chefin mache deswegen „Terror“, informierte Schmid 2017 den damaligen Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP). Und er beruhigte die Stiftungsinhaberin, sicherte ihr eine ablehnende Stellungnahme des Ministeriums zu dem Entwurf zu. Eva Dichand soll, was diese bestreitet, mit unfreundlicher Berichterstattung über die ÖVP-FPÖ-Regierung gedroht haben. „Wir können auch anders“, soll sie Schmid dessen Aussagen zufolge gewarnt haben.
Auch SPÖ „kaufte“ Medien
Wie auch immer: Das Gesetz kam tatsächlich nicht und das Inseratenaufkommen des Finanzministeriums entwickelte sich wunschgemäß: 2017 erhielt die Krone mit 810.000 Euro die meisten Einschaltungen vor Heute mit 730.000 Euro, während Österreich mit 671.000 Euro nur noch auf Platz drei landete. Insgesamt explodierten die Inseratenvolumina proportional mit dem Einfluss von Sebastian Kurz. Hatte das Finanzministerium 2015 noch für nur 135.000 Euro in Medien inseriert, so waren es im Ibiza-Skandaljahr 2019 schon 7,4 Millionen. Die Dichands und alle anderen, die in den Genuss dieser staatlichen Inserate kommen, bestreiten energisch jeglichen Einfluss auf die Berichterstattung.
Insider zeichnen ein anderes Bild: Vor zwei Jahren hatte der ehemalige Krone-Ressortleiter Thomas Schrems aus der Praxis der „Verhaberung“ zwischen Politik und großen Medienhäusern geplaudert. So hätte Dichand kritische Berichte über die städtische Wohnbaugesellschaft „Wiener Wohnen“ mit Hinweis auf die vielen Inserate der SPÖ-regierten Stadt Wien abgestellt. Dichand bestreitet das. Ex-SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern sprach sogar von einer „Erbsünde der SPÖ“, weil diese den Boulevard mit Inseraten gemästet habe.
Der PR-Ethikrat hatte schon vor sieben Jahren in von der Politik vergebenen Inseraten ein „demokratiepolitisches Problem“ gesehen und beklagt, dass niemand darüber diskutieren wolle. Jetzt bleibt Österreichs Medienhäusern diese Diskussion nicht mehr erspart, auch wenn sie es nicht gewohnt sind, vor der eigenen Türe zu kehren.

 De Maart
De Maart



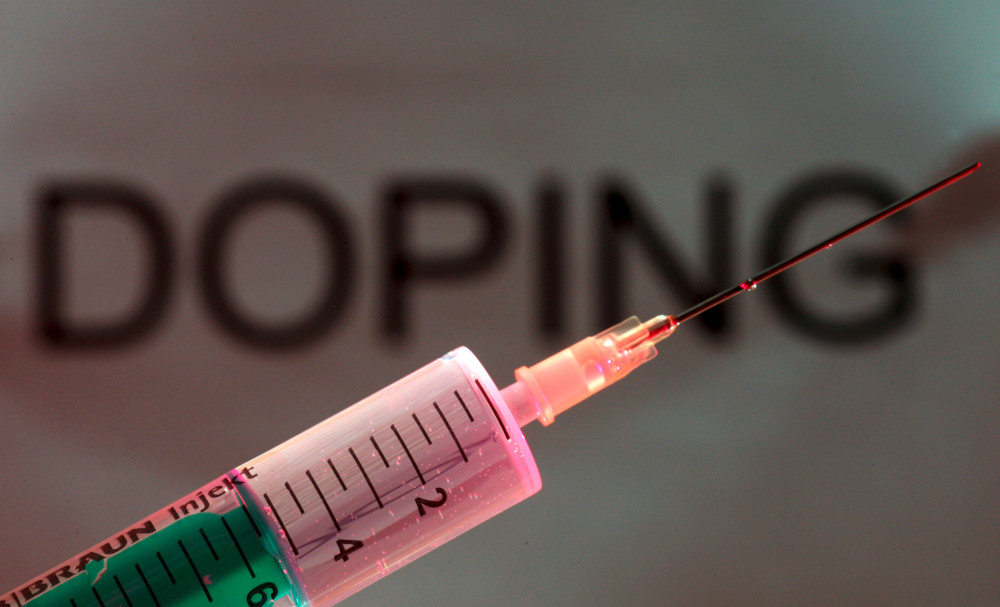



Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können