Für die Geschichtswissenschaft und die historische Linguistik sind die ersten überlieferten Stadtrechnungen Luxemburgs aus den Jahren 1388 bis 1500 eine wertvolle Quelle. Denn diese Papiere, die durchgehend in Deutsch verfasst sind, geben einen Einblick in das Alltagsleben und die Verwaltungspraxis im Mittelalter. Für nur wenige andere Städte ist eine so dichte Serie von Rechnungsbüchern erhalten.
In einem grenzübergreifenden Kooperationsprojekt erforschten das Historische Institut der Universität Luxemburg mit Michel Pauly und Martin Uhrmacher, die Professur für Germanistik / Ältere Deutsche Philologie – Historische Linguistik an der Universität Trier mit Claudine Moulin sowie das Stadtarchiv Luxemburg mehr als 15 Jahre lang die Dokumente. Das Ergebnis ist eine kritische Edition mit zwölf Bänden, die kürzlich abgeschlossen und im Rathaus der Stadt Luxemburg vorgestellt wurde. Mit dabei war Bürgermeisterin Lydie Polfer.
Anhand der rund 70 im Stadtarchiv erhaltenen Einnahmen- und Ausgabenregister sowie weiterer ergänzender Quellen haben Trierer Sprachwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler die Entstehung von Familiennamen in der Stadt Luxemburg nachvollzogen. Aber auch zu Mechanismen der städtischen Mehrsprachigkeit lieferten die erhaltenen Quittungen wesentliche Erkenntnisse.
„Urbanes Lexikon der Kommunikation“
„Für die europäische Sprachgeschichtsschreibung sind unsere aus den Rechnungsbüchern gewonnenen Forschungsergebnisse von grundlegender Bedeutung“, sagt die Trierer Professorin Claudine Moulin. Viele der in den Kontenbüchern verwendeten Fachbegriffe beispielsweise zu Bauwerken oder Werkzeugen sind anderswo kaum erfasst – beispielsweise in mittelalterlichen Wörterbüchern. „Basierend auf den Rechnungen konnten wir quasi ein ‚urbanes Lexikon‘ der Kommunikation in der damaligen Stadt Luxemburg erstellen.“

Auch für die Luxemburger Historikerinnen und Historiker sind die Kontenbücher eine ergiebige Quelle. Die Forschenden identifizierten, dass viel Geld für den Ausbau und den Unterhalt der Stadtmauer mit ihren Türmen und Toren verwendet wurde. Vor allem verfolgten sie unter anderem die geografische Herkunft der Baumaterialien, den genauen Ablauf der Arbeiten und die einzelnen Schritte des Bauprozesses sowie den Fortgang des Mauerbaus bis ans Ende des 15. Jahrhunderts. Die Angaben in den Rechnungsbüchern halfen, das spätmittelalterliche Rathaus der Stadt weitgehend zu rekonstruieren. Auch kulturgeschichtliche Hinweise sind darin fassbar. Es geht etwa um Mysterienspiele, die die Luxemburger aufgeführt haben, oder Freudenfeuer, die sie veranstalteten.
Schrift und Sprache im Wandel der Zeiten
„Das Besondere an unserer Edition ist, dass die mittelalterliche Schreibweise genauestens respektiert wurde, also keine Standardisierung von historischen Schreibungen vorgenommen wurde. So sind die Erscheinungen des Sprach- und Schriftwandels nachvollziehbar“, erläutert Moulin.
Bezugsquelle
Die zwölf Bände können unter www.cludem.lu/publications bestellt werden.
Ein Einzelband kostet 19 Euro, beim Kauf der ganzen Reihe 15 Euro.
Dank der Arbeit der beteiligten Forschenden gilt die Stadt Luxemburg heute international als hervorragend erschlossenes Beispiel für Forschungen zur städtischen Buchhaltung, zur Alltagsgeschichte und zur Stadtsprache im Spätmittelalter. Verschiedene Aspekte der Sprache in der mittelalterlichem Stadt behandeln auch Fausto Ravida, Andreas Gniffke, Stephan Lauer und Dominic Harion in Doktorarbeiten. Sie entstanden bei dem Kooperationsprojekts an der Universität Trier und wurden zum Teil vom „Fonds national de la recherche“ (FNR Luxembourg) unterstützt.
Doch mit dem nun vorliegenden Abschluss der gedruckten Ausgabe ist die Forschung zu den Rechnungsbüchern noch nicht beendet. In einem nächsten Schritt wird das Material für eine digitale Edition vorbereitet. Sie soll neben der Präsentation der Originaldokumente auch vielfältige Recherchemöglichkeiten bieten. An dem geplanten Kooperationsvorhaben wird neben Universität und Stadtarchiv Luxemburg auch das Trier Center for Digital Humanities (TCDH) beteiligt sein. Es stellt laut Universität international einen der besten Partner für den Bereich der digitalen Edition historischer Quellen dar.
Die beiden Hochschulen und die Stadt Luxemburg haben das Projekt finanziell gefördert.

 De Maart
De Maart




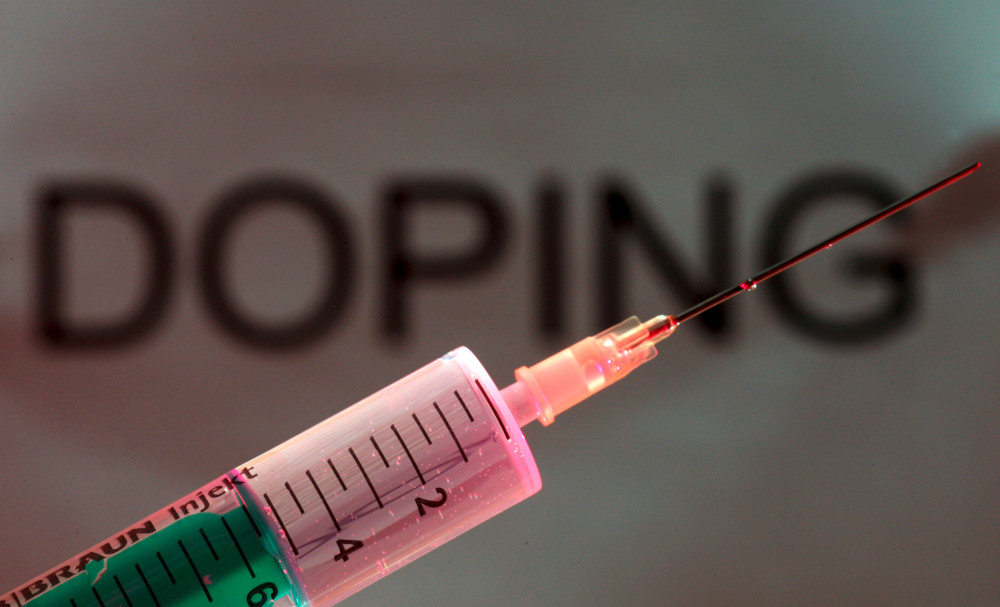


Bei der Autorin des Buches "Die Tötung Geisteskranker in Deutschland" handelt es sich um Frau Dr. med. Alice RICCIARDI-PLATEN-HALLERMUND.
MfG
Robert Hottua
Als ich diesen Artikel heute morgen gegen fünf Uhr las, fiel mir gleich der untenstehende Text ein. Nach einigem Zögern schicke ich ihn jetzt los. Meine Intention ist zu zeigen, dass auch die Aufarbeitung von neuzeitlichen ländernachbarschaftlichen Themen mit ideellem und finanziellem Engagement in Angriff genommen werden sollte/muss. Der deutsche Medizinhistoriker Matthias KLEIN hat vor einigen Jahren einen dementsprechenden Anfang gemacht. Herr Bernd WIENTJES vom "Volksfreund" hat darüber am 17. März 2019 berichtet.
▪ Die Tötung Geisteskranker in Deutschland
Vorwort zur Neuauflage von 1993
1946 wurde eine Kommission unter Leitung von Dr. Alexander MITSCHERLICH durch die Ärztekammer beauftragt, den sogenannten Ärzte-Prozess vor dem Nürnberger Militärgericht zu beobachten. Die Anklage betraf Ärzte in Konzentrationslagern, die Menschenversuche durchgeführt hatten, und die Ärzte und Beamten der sogenannten Euthanasie-Aktion Hitlers zur Tötung der Geisteskranken.
Als die Berichte veröffentlicht wurden, war das hungernde Deutschland an solchen Fragestellungen nicht interessiert und auch die Ärztekammer selbst wollte die Tätigkeit so vieler Ärzte an verantwortlicher Stelle an Vernichtungsaktionen nicht bekannt werden lassen. So ist diese erste Dokumentation nie verbreitet worden und erst die viel ausführlicheren Werke von KLEE, KAUL, NOWAK, REITLINGER etc. haben das Schweigen gebrochen.
Als ich damals versuchte, die psychologischen Ursprünge der Massentötungen zu erklären und ihren weltanschaulichen Wurzeln nachzugehen, musste ich die rassenhygienische Literatur durcharbeiten, die zum Pflichtfach für Medizinstudenten unter dem Nationalsozialismus erhoben worden war. Die Nürnberger Verteidiger führten sie als wissenschaftliche Rechtfertigung der Angeklagten an; diese Literatur wies immer wieder auf die Notwendigkeit hin, den "Volkskörper" von der Vergiftung durch "Entartete" zu befreien und seine ursprüngliche (wann?) Reinheit wiederherzustellen. Zur Erreichung dieses Ideals sei jedes persönliche Opfer zu verantworten. (…)
Ich möchte an dieser Stelle Herrn Prof. Klaus DÖRNER und dem "Psychiatrie-Verlag" meinen herzlichen Dank aussprechen für die Neuauflage des Büchleins.
▪ Geleitwort zur Neuauflage 1993
Von Dr. med. Klaus DÖRNER
Dieses Buch ist der erste Versuch, die medizinischen und insbesondere die psychiatrischen Verbrechen der Nazis darzustellen, ihre historischen Wurzeln aufzuzeigen, die konkrete Organisation dieser Verbrechen am Beispiel Hessens zu dokumentieren und auch noch den Persönlichkeiten einiger Täter gerecht zu werden. Der schreckliche Inhalt des Buches verschlug uns allen in Deutschland offenbar so sehr die Sprache, dass es - ebenso wie die wenigen ähnlichen Bücher - nach kurzer Zeit weitgehend erfolgreich vergessen und verdrängt werden konnte. Ab der zweiten Hälfte der 60er Jahre waren einige wenige von uns so weit, dass sie sich an die Entdeckung oder Wiederentdeckung des Buches wagten. Es musste aber noch einmal viele Jahre dauern, bis ab 1980 abrupt und exlosionsartig sehr viele und noch jüngere Deutsche sich noch weiter wagten: von dieser Zeit an wurde dieses Buch nach Form und Inhalt zum Prototyp für eine Flut von Büchern und Aufsätzen, die sich bemühten, insbesondere die NS-Psychiatrie-Verbrechen inzwischen fast jedes psychiatrischen Krankenhauses und fast jeder Einrichtung für geistig Behinderte und fast jeder Region des Deutschen Reiches zu rekonstruieren. Plötzlich war möglich geworden, was jahrzehntelang allen Älteren die Augen geblendet und die Kehle zugeschnürt hatte. Die wenigen Exemplare des Buches wurden jetzt mühsam gesucht, der kollektiven Verdrängung entrissen. (…) Die heutige Lektüre des Buches zeigt, dass fast alle grundlegenden Gedanken zur Erklärung, soweit das überhaupt möglich ist, der psychiatrischen NS-Verbrechen schon 1948 gedacht und ausgesprochen waren, offenbar für uns historisch zu früh, so dass wir ab 1980, trotz unseres jetzt viel größeren Wissens, oft dieselben Erklärungsansätze wiederfinden mussten - jetzt freilich mit einer größeren Resonanz und Bereitschaft, sich ihnen auszusetzen. So beschreibt die Autorin schon 1948 die wichtige Täter-Fraktion der "Idealisten", die aus einem Gemisch aus revolutionärer Begeisterung, die Gesellschaft heilen zu können, und "im tödlichem Mitleid" gehandelt und gemordet haben. (…)
MfG
Robert Hottua