Atomkraftwerke sind gut für das Klima. Die Atomlobby wird nicht müde, dieses umstrittene Narrativ zu pflegen. Atomkraftwerke stoßen relativ geringe Mengen an klimaschädlichen Gasen aus. Im Vergleich zu Kohlemeilern jedenfalls wirken sie wie blitzsaubere Energielieferanten. Nicht ohne Grund sind bei UN-Klimakonferenzen stets viele Befürworter der Atomkraft anwesend. Namhafte Vertreterinnen und Vertreter von Fridays for Future haben sich für die Nutzung der Kernenergie ausgesprochen, bis hin zur Klimaschutz-Ikone Greta Thunberg.
Hauptgrund für den Rückhalt bei Klimaaktivisten dürfte jedoch nicht ein Faible für Atomkraft sein. Vielmehr geht es den Befürwortern unter den Klimaschützern um eine Übergangszeit, bis erneuerbare Energien so umfangreich vorhanden sind, dass konventionelle Kraftwerke, die Kohle oder Gas verbrennen, und eben Atommeiler nicht mehr benötigt werden. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg, wenn man sich den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung weltweit anschaut: Sonne, Wind- und Wasserkraft machten weniger als ein Drittel im Jahr 2022 aus, wie öffentlich zugängliche Daten zeigen. In Deutschland sind es mittlerweile 46 Prozent. Die Frage lautet daher, ob es sich einzelne Staaten oder Staatengemeinschaften leisten können, auf Atomkraft zu verzichten, wenn sie ihre Klimaziele erreichen wollen?
Die deutsche Regierung hat diese Frage ganz klar mit Ja für sich beantwortet. In wenigen Tagen geht in Deutschland die Ära der Kernenergienutzung nach 60 Jahren zu Ende. Am 15. April werden die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz genommen. Danach werden Jahrzehnte folgen, in denen man sich in der Bundesrepublik um den Rückbau und vor allem um die Endlagerung des Atommülls kümmern muss.
Parallel dazu stehen wichtige Meilensteine bei den Klimazielen an. Mit der Änderung des Klimaschutzgesetzes hat die deutsche Regierung die Klimaschutzvorgaben zuletzt verschärft und das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 verankert. Bereits bis 2030 sollen die Emissionen um 65 Prozent gegenüber 1990 sinken. Um das zu erreichen, sind gewaltige Kraftanstrengungen beim Ausbau erneuerbarer Energien nötig. So brachte es Kanzler Olaf Scholz jüngst auf die einfache Formel, dass bis 2030 jeden Tag im Schnitt vier bis fünf Windräder gebaut werden müssten. Zugleich berichtet SPD-Chef Lars Klingbeil von einem Windradprojekt in seinem niedersächsischen Wahlkreis, das seit 18 Jahren nicht realisiert wird. Die Kluft zwischen Anspruch und Ziel einerseits und der Realität im Planungsdschungel andererseits ist mitunter sehr groß.
Erneuerbare kompensieren Atomstrom
Dennoch betonte die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne), die qua Amt auch für die nukleare Sicherheit in Deutschland verantwortlich ist, noch in der vergangenen Woche, dass der Atomausstieg richtig sei. Er mache das Land sicherer angesichts der enormen Risiken, die ein – wenn auch unwahrscheinlicher – Reaktorunfall mit sich brächte. Zudem werde gefährlicher Atommüll eingespart. Und fast noch wichtiger angesichts der laufenden Debatten: Auch wenn die AKW nun abgestellt werden, seien die Klimaziele Deutschlands erreichbar, so Lemke. Dabei verwies sie darauf, dass der Atomstrom durch den Zubau erneuerbarer Energien kompensiert werden könne.
Die Zahlen dazu: 2021 wurde noch zu 57,7 Prozent Strom aus konventionellen Energieträgern ins Netz eingespeist und zu 42,3 Prozent aus erneuerbaren Quellen. 2022 lag der Anteil der Konventionellen bei 53,7 Prozent. Doch während Atomstrom von 12,6 Prozent Anteil in 2022 auf 6,4 Prozent in 2021 zurückgegangen war, stieg der Anteil der Kohlestromeinspeisung auch in Folge des Krisenmanagements nach dem russischen Überfall auf die Ukraine deutlich von 30,2 (2021) auf 33,3 Prozent (2022). Bei Windkraft und Fotovoltaik waren die Sprünge ähnlich groß: Windstrom machte 2021 noch 21,6 Prozent aus, 2022 waren es 24,1 Prozent. Und Strom aus Sonnenenergie hatte einen Anteil von 8,7 Prozent in 2021 und 10,6 Prozent in 2022. Alle übrigen Anteile anderer Energieträger – konventionell wie erneuerbare – blieben weitgehend bei den Vorjahreswerten.
Atomkraft ist Teil des Pakets
Lemkes Argument, dass Atomstrom durch den Zubau Erneuerbarer vollständig ersetzt werden kann, wird auf EU-Ebene jedoch vorerst noch nicht geteilt. Mehrheitlich setzt man sich in Europa weiterhin für den Weiterbetrieb und den Ausbau der Kerntechnik ein. So stellte die EU-Kommission jüngst das sogenannte Netto-Null-Industrie-Gesetz (Net Zero Industry Act) vor. Mit dem EU-Gesetzespaket sollen bis 2030 rund 40 Prozent des jährlichen Bedarfs an sauberen Technologien in der EU selbst produziert werden. „Green-Tech“-Branchen können auf mehr Fördermittel und beschleunigte Genehmigungsverfahren hoffen. Gefördert werden sollen Windkraft- und Fotovoltaik-Anlagen, Wärmepumpen und grüner Wasserstoff, aber auch die umstrittene Kohlenstoffspeicherung unter der Erde.
Die Atomkraft ist nach massivem Tauziehen hinter den Kulissen nun Teil des Pakets, mit dem die EU ihre Klimaziele erreichen will. Dies hatte vor allem Frankreich gefordert. Die Atomenergie sei „sauber“, sagte nun der französische EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton, der das Projekt federführend verantwortet.
Doch auch andersherum gibt es Wirkungen, nämlich vom Klimawandel auf die Atomkraftwerke. Erneut Beispiel Frankreich: Präsident Emmanuel Macron rief angesichts der monatelangen Dürre landesweit zum Wassersparen auf – auch bei den Atomkraftwerken. „Wir müssen unsere Atomkraftwerke an den Klimawandel anpassen“, sagte Macron. Im vergangenen Sommer waren mehrere Atomkraftwerke gedrosselt worden, weil das Kühlwasser die Flüsse mit niedrigem Wasserstand zu sehr aufzuheizen drohte.

 De Maart
De Maart





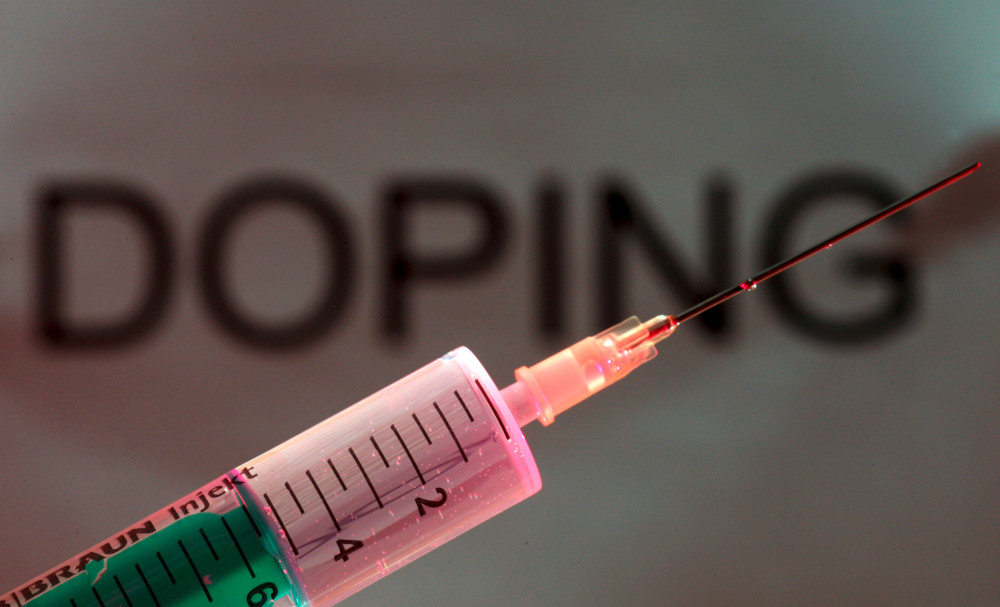

Eigenartigerweise sind es gerade die Japaner, welche trotz Fukoshima vermehrt auf Atomkraft setzen.
Wenn man die Ursachen des Unglückes, genauso die von Tschernobyl analysiert, kommt man zum Schluss, dass in unseren Breitengraden keine Tsunamis, noch heftige Erdbeben zu registrieren sind. Menschliches Versagen, sprich Unvermögen, war in Tschernobyl die Ursache. Dass die Operateure des AKW Cattenom um Klassen besser arbeiten beweist die 40jährige Erfolgsgeschichte des Atomzentrale.
Aber wie heisst es so schön, "Angst essen Seele auf"... bei vielen Bürgern, besonders grüngefärbte, leider auch den logischen Sachverstand.
Kein Wunder wenn viele Bürger überfordert sind mit Meinungen zum Thema Energiewende weil auf den ersten Blick nicht koherent : einerseits ist D Vorreiter beim Ende der AKWs, anderseits Bremsklotz bei Elektromobiltät - sprich Ausnahmeregelung von E fuels.
Eine Physikerin wie Merkel hat eben nach Fukishima Gewissensbisse bekommen und der jetzige Bundeskanzler hat kein Rückgrat die Autolobby und die konservative Dinosaftfraktion ein falches Versprechen zu ersparen.
Dabei sind die Anzahl der Toten durch Feinstaub wesentlich höher wie die Gesammtzahl derjenigen, die bei einem AKW Unfall ums leben kamen.
Die Klimaziele sind zu erreichen,aber die Stromversorgung nicht. Brownout -die gezielte Abschaltung von Stromverbrauchern um die Überlastung des Netzes zu vermeiden. Die E-Autoflotte steht ganz vorne auf der Liste. Aber wer Mehlwürmer essen kann,der kann auch auf sein Auto verzichten.Schöne grüne Welt.