Einstimmig verwarfen die fünf Höchstrichter das Projekt der schottischen Nationalisten-Regierung, in eigener Regie eine „konsultative“ Volksabstimmung zu veranstalten. Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon sicherte in Edinburgh zu, die Entscheidung zu respektieren, auch wenn diese „eine bittere Pille“ darstelle: „Wir haben ein klares demokratisches Mandat.“
Befürworter der Abspaltung vom Vereinigten Königreich verfügen im Edinburgher Parlament über eine eindeutige Mehrheit. Die Nationalistenpartei SNP und die mit ihr kooperierenden Grünen wollten deshalb per Gesetz die Abstimmung für den Oktober kommenden Jahres anberaumen. Weil sie Zweifel an der Legalität des Vorgehens hatte, legte die oberste Juristin der schottischen Regierung, Dorothy Bain, dem Supreme Court das Gesetz vor.
In der mündlichen Anhörung im Oktober hatten die Advokaten der damaligen Tory-Regierung unter Liz Truss die Zuständigkeit des Gerichts bestritten: Dieses solle frühestens dann tätig werden, wenn das schottische Parlament das entsprechende Gesetz auch wirklich beschlossen habe. Die Argumentation wies Gerichtspräsident Robert Reed, ein Schotte, in seiner lediglich zehnminütigen Erklärung kühl zurück: Es gehe um das sogenannte Schottland-Gesetz des britischen Unterhauses, dafür sei man allemal zuständig.
Die sprachliche Spitzfindigkeit der Nationalisten, wonach die Abstimmung lediglich „konsultativen Charakter“ haben solle, tat das Gericht brüsk ab: Natürlich hätte das Ergebnis, egal welcher Art, politische Konsequenzen. Da aber das Schottland-Gesetz die Zustimmung des Unterhauses erfordere, sei der Plan damit null und nichtig.
Im Vorfeld der ersten Abstimmung von 2014 hatten der damalige Nationalistenführer Alex Salmond und der damalige konservative Premierminister David Cameron bereits zwei Jahre zuvor die Bedingungen des Referendums ausgehandelt, ehe das Unterhaus dem schottischen Parlament die verfassungsrechtlich vorgeschriebene Zustimmung erteilte. Am Ende des monatelangen Abstimmungskampfes votierten die Schotten mit 55:45 Prozent für den Verbleib ihres Königreiches in der Union mit England.
Rahmenbedingungen durch den Brexit völlig verändert
Seither verweisen Londoner Politiker aller unionsweiten Parteien auf die damalige SNP-Position, wonach die Abstimmung „für eine Generation“ gelten werde. Sämtliche Nachfolger Camerons im Amt haben die Zustimmung zu einem neuerlichen Votum mit der Begründung verweigert, es sei „jetzt nicht die Zeit“. Anders als seine Vorgänger Boris Johnson und Liz Truss, die sich gern herablassend über Sturgeon geäußert hatten, gab sich Premier Sunak am Mittwoch betont zurückhaltend: Man strebe eine gute Zusammenarbeit mit den Regierungen aller Regionen des Vereinigten Königreiches an.
Die Unabhängigkeitsbefürworter sehen die politischen Rahmenbedingungen durch den Brexit komplett verändert. Beim EU-Referendum stimmten die Schotten 2016 mit 62 Prozent für den Verbleib, seither haben sie in allen Wahlen die SNP als dominierende politische Kraft bestätigt. Im Fall der Unabhängigkeit will Sturgeon ihre Nation an den Brüsseler Verhandlungstisch zurückführen.
Zunächst muss die Ministerpräsidentin jetzt ihre nächsten Schritte planen. Im Unterhaus erklärten mehrere Nationalisten die Idee der freiwilligen Union der beiden Königreiche für einen „Mythos“; Allan Dorans sprach sogar davon, Schottland sei „angekettet und eingesperrt“. Die politische Union besteht seit 1707, bereits seit 1605 haben beide Nationen denselben Monarchen.
Auf gegenwärtige Probleme fokussieren
Das rhetorische Sperrfeuer der SNP-Vertreter richtet sich nicht zuletzt an ungeduldige Unabhängigkeitsbefürworter in den eigenen Reihen. Zwar ist die radikalere Alba-Party des früheren Ministerpräsidenten Alex Salmond in der Versenkung verschwunden; acht Jahre nach Sturgeons Einzug ins höchste Partei- und Staatsamt wird aber das innerparteiliche Murren über ihr vorsichtiges und streng legalistisches Vorgehen vernehmlicher. Zudem zerfleischt sich die Edinburgher Parlamentsfraktion über ein neues Transsexuellen-Gesetz.
Unter den Schotten insgesamt gibt es Umfragen zufolge wenig Appetit auf eine zweite Unabhängigkeitsabstimmung im kommenden Jahr. Darauf wies der konservative Oppositionsführer in Edinburgh, Douglas Ross, hin. Labour-Chef Anas Sarwar machte den Versuch, die politische Debatte auf Sturgeons Regierungshandeln zu richten: „Wir sollten auf unsere Probleme fokussieren, etwa die Krise im NHS.“ Tatsächlich liegen Gesundheitswesen, aber auch Schulen in der Zuständigkeit der Regionalregierung und vielerorts im Argen. Seit einiger Zeit werden die Fragen bohrender, ob die seit 15 Jahren regierenden Nationalisten ihre bestehenden Kompetenzen ausnutzen und die Staatskasse gut verwalten.
Kommentar: Unnötiges Gerichtsverfahren
Dieses Gerichtsverfahren war vollkommen unnötig. Das Gesetz, mit dem das schottische Parlament 1999 wiedereingerichtet wurde, lautet eindeutig: Über die Union der beiden Königreiche entscheidet das Unionsparlament in London. Die Freigabe für die 2014 erfolgte Volksabstimmung über Schottlands Unabhängigkeit erteilte das Unterhaus. Das Ergebnis war mit 55:45 Prozent für den Verbleib in der mittlerweile 315 Jahre alten Union mit England eindeutig.
Dass die Edinburgher Nationalistenregierung jetzt wegen einer zweiten Abstimmung den britischen Supreme Court anrief, hatte ebenso performativen Charakter wie ihre dauernden Beteuerungen, als unabhängige Nation werde Schottland dem Paradies ganz nahe sein. In Wirklichkeit steht der britische Norden nach 15 Jahren SNP-Regierung nämlich nicht rosig da.
Wahr ist aber auch: Der mit englischen Stimmen durchgesetzte Brexit mit all seinen negativen Auswirkungen und das anhaltende Tory-Chaos in London haben die politischen Rahmenbedingungen stark verändert. Das Argument, wonach das Votum von 2014 für eine Generation gelten müsse, wird von Tag zu Tag schwächer. Die Unionistenparteien, angeführt von Konservativen und Labour, werden sich Besseres einfallen lassen müssen, wenn sie dem nationalistischen Spaltpilz beikommen wollen.
Sebastian Borger

 De Maart
De Maart



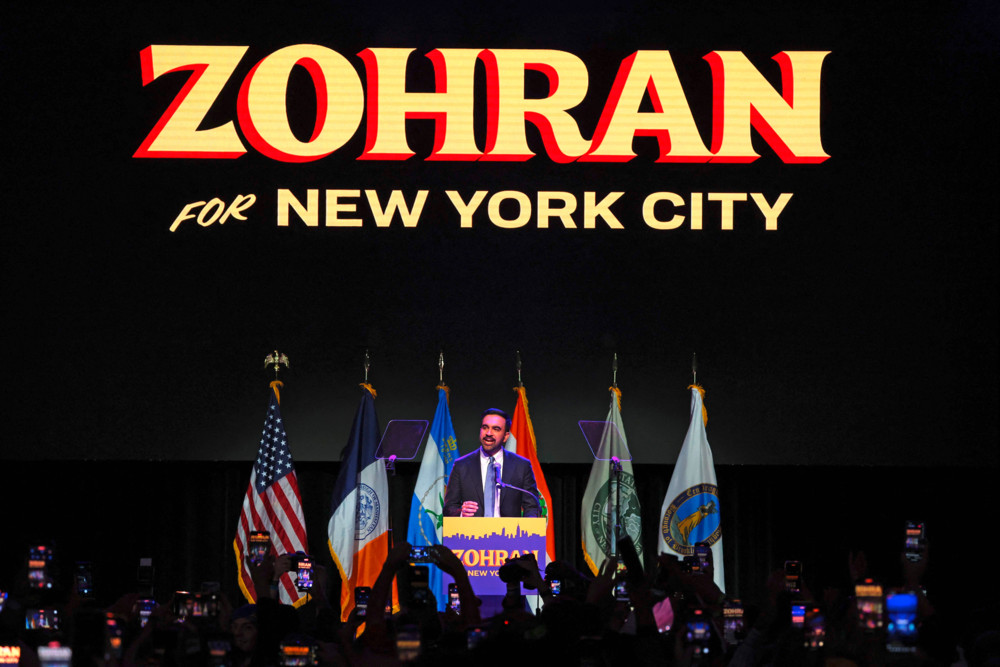



Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können