Als erster Verband entschied die FLH am vergangenen Montag zusammen mit den Vereinen, dass die Schnelltests in der AXA League Pflicht sein sollen. Innerhalb von 48 Stunden vor jedem Spiel müssen sich die Handballer und Handballerinnen den Tests unterziehen. Bei den meisten Klubs hat man sich dazu entschieden, diese im Rahmen des Abschlusstrainings durchzuführen.
Bei den Handballern aus Käerjeng wird dieses freitagabends abgehalten. Um rechtzeitig mit der letzten Trainingseinheit vor ihrem Spiel gegen den HBD beginnen zu können, traf die Damenmannschaft des HBK gestern bereits 45 Minuten vor Trainingsanfang ein, um die Schnelltests über die Bühne zu bekommen. In den ersten beiden Wochen werden diese noch von dem Pflegedienst „Päiperléck“ übernommen, danach sollen diese von medizinisch geschultem Personal des Vereins weitergeführt werden. „Wir haben das Glück, dass die Mutter eines unserer Jugendspieler Krankenschwester ist. Sie hat angeboten, uns zu helfen. Unsere Physiotherapeuten haben zudem an der Online-Weiterbildung teilgenommen. So haben wir drei bis vier Leute, die nach den ersten zwei Wochen die Tests durchführen können“, sagt Vereinspräsident Yannick Schuler.
In Käerjeng wurde oberhalb der Tribünen ein Raum für die Ausführung der Schnelltests vorbereitet. In dessen Eingang wurde ein Empfang eingerichtet, dort bekommt jede Spielerin eine Nummer zugeteilt, mit der sie in der Ergebnisliste geführt wird. Von dort geht es anschließend zum „Päiperléck“-Pflegepersonal, das mit Schutzanzügen, Hauben, Schutzbrille, Maske und Handschuhen wartet. Auf einem langen Tisch liegt das Testmaterial bereit, davor stehen zwei Stühle, auf denen die Spielerinnen Platz nehmen. Den Kopf müssen sie nach hinten lehnen und ihre Maske beiseiteschieben. Mit einem Wattestäbchen wird dann ein Abstrich in der Nase entnommen. Dass dies ein unangenehmes Gefühl ist, kann man unschwer in ihren Gesichtern erkennen.
Pro Mannschaft werden ungefähr 20 Leute getestet, inklusive Spieler, Trainer und Betreuer
Der Abstrich wird anschließend mit einer Flüssigkeit vermischt, davon kommt ein Tropfen auf den Schnelltest. Auf das Plastikgehäuse wird mit einem wasserfesten Stift anschließend die Nummer geschrieben, die die Spielerinnen im Eingang zugeteilt bekommen haben. All dies passiert innerhalb einer knappen Minute, danach heißt es aber eine Viertelstunde warten, bis das Resultat angezeigt wird. Auf ihren Smartphones stellen sich Käerjengs Handballerinnen einen Timer von 15 Minuten. Nach Ablauf der Zeit bekommen sie ihr Testergebnis mitgeteilt. Leuchtet nur ein Strich auf dem Schnelltest auf, dann ist dieser negativ. Leuchtet aber auch der zweite Strich auf, bedeutet dies, dass der Test positiv ist. „Es ist wie bei einem Schwangerschaftstest“, scherzt einer der beiden „Päiperléck“-Mitarbeiter.
Innerhalb von 45 Minuten waren alle Spielerinnen, der Trainer und die Betreuer getestet, sodass das Training rechtzeitig beginnen konnte. Für Schuler war die Testprozedur zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht abgeschlossen. „Nach den Damen sind die Männer dran. Pro Mannschaft werden ungefähr 20 Leute getestet, inklusive Spieler, Trainer und Betreuer“, so Schuler. Anschließend muss die Liste mit allen Ergebnissen an den Verband weitergeleitet werden, denn nur die Spieler, die gestern negativ getestet wurden, sind heute spielberechtigt.
Fußball: Ablehnung führt zur Absage
Die Fußballvereine der BGL Ligue haben unterdessen für das erste Test-Tohuwabohu gesorgt. Ihre Ablehnung gegenüber dem Konzept hat zur Absage des Neustarts geführt (siehe Seite 31). Vor allem die Logistik und die Kosten bereiten den Klubs Sorgen. Rund acht bis zehn Stunden pro Woche und bis zu 40 Stunden im Monat würden vor und nach dem Training draufgehen, um einen gesamten Kader testen zu können. Im Durchschnitt gehören etwas mehr als 20 Spieler zum Aufgebot eines BGL-Ligue-Vereins. Hinzu kommen die Trainer und Betreuer, die getestet werden müssen, da sie sich dauerhaft in der Nähe der Spieler befinden. Nur wenige Vereine verfügen über einen Physiotherapeuten oder medizinisches Personal, das dauerhaft die Mannschaft begleitet. Es würden demnach zusätzliche Kosten anfallen. Bei fast 40 Teststunden pro Monat müsste ein Verein fast ein komplettes Gehalt auszahlen, um sich diese sanitäre Sicherheit leisten zu können. Für die Topvereine ist dies kein Problem, für die kleineren Klubs eine weitere hohe Hürde in bereits schwierigen Corona-Zeiten.
Bei der US Mondorf werden schon seit ein paar Wochen Schnelltests eingesetzt. Der Verein führt Stichproben bei Spielern durch, bei denen Symptome auftauchen. Die ganze vom Sportministerium geforderte Prozedur auf sich zu nehmen, kam für den Verein bis gestern eher nicht in Frage. Auch der nationale Fußballverband hat eine gewisse Skepsis gegenüber dem Konzept entwickelt: „Es ist nur möglich, alle Spieler zu testen, wenn ein Labor diese durchführt. Die meisten Vereine sind mit den Anforderungen überfordert und wir als Verband können auch keine Hilfe leisten“, sagt FLF-Generalsekretär Joël Wolff. Bis Saisonende müssten in der BGL Ligue über 5.500 Tests durchgeführt werden, fast 1.500 Stunden müssten in Anspruch genommen werden. Die Kosten bewegen sich im hohen vierstelligen Bereich, wenn die Vereine medizinisches Personal anheuern müssen.
Das Sportministerium hatte vor der Veröffentlichung der Schnellteststrategie Kontakt mit einem Labor aufgenommen. Das angebotene Testpackage hätte den Staat noch einmal 1,5 Millionen Euro gekostet. In Krisenzeiten zu viel. Ein Beispiel für solch eine Zusammenarbeit findet man bei der Europäischen Fußballunion. Die UEFA arbeitete bei internationalen Spielen mit dem deutschen Labordienstleister Synlab zusammen. Ein lukrativer Auftrag für die Firma mit Sitz in München. Seit dem Ausbruch der Pandemie waren die mobilen Labore bei Tausenden von Spielen in Einsatz. Dass aber auch dieses „Mega-Lab“ nicht einwandfrei funktioniert, zeigte ein Beispiel vom 27. August 2020. Bei der Europa-League-Partie zwischen dem Progrès Niederkorn und dem montenegrinischen Vertreter FK Zeta wurde ein Spieler positiv getestet. Das Resultat lief aber erst in der 75. Minute des Spiels ein.
Testpflicht auch bei der FLBB und FLVB
Nachdem der Handballverband bereits am Dienstag mitteilte, dass man in der AXA League eine Testpflicht einführen würde, schlossen sich der Basketball- sowie der Volleyballverband dieser Leitlinie an.
„Die Schnelltests werden auch im Basketball obligatorisch sein“, bestätigte FLBB-Präsident Samy Picard am gestrigen Freitag. Dabei wird man sich bei den Basketballern weitestgehend am Konzept der Handballer orientieren. So können die Klubs selbst entscheiden, wer die Tests durchführen wird, bei Problemen wird der Verband unterstützend zur Seite stehen. „Bei uns werden die Tests jeden Freitag von einem Arzt durchgeführt, der im Verein tätig ist“, erklärte beispielsweise Walferdingen-Präsident Alain Weins. Bereits vor der Entscheidung des Verbandes hatte man sich beim Klub aus dem Alzette-Tal dazu entschieden, dass sich alle Spieler den Tests unterziehen müssen, wenn sie denn spielen wollen: „Dafür hatten alle Verständnis“, betonte Weins, der auch die unproblematische Bestellung der Schnelltests lobte: „Am Tag, nachdem wir sie per Mail bestellt hatten, konnten wir sie auch schon im INS abholen.“ Für den „Restart“ in der Total League der Damen am kommenden Wochenende ist die Résidence demnach bereits gerüstet.
Am heutigen Samstag steht in der höchsten Spielklasse der Damen aber bereits eine Nachholpartie zwischen den Musel Pikes und Ettelbrück auf dem Programm. Aufgrund der Kurzfristigkeit hat die FLBB dann auch speziell für dieses Spiel den Pflege- und Gesundheitsdienstleister „Päiperléck“ beauftragt, die Schnelltests direkt vor der Partie durchzuführen. So können die Mannschaften auch sofort einen Eindruck gewinnen, wie das Ganze abläuft. Viele Teams haben nun erst einmal zwei Wochen Zeit, das Prozedere mit ihren Damenteams durchzugehen, bevor Ende Februar auch die Total League der Herren wieder ihren Spielbetrieb aufnimmt.
Nach einer Videokonferenz des Volleyballverbandes FLVB am Donnerstag mit den Vereinen der ersten Ligen haben sich auch hier sämtliche Klubs dazu verpflichtet, die Schnelltests einzusetzen. Wie diese durchgeführt werden, soll in einer weiteren Videokonferenz in der kommenden Woche endgültig entschieden werden, wo man alle weiteren Details durchgehen wird. Im Gegensatz zu den anderen drei großen Mannschaftssportarten nimmt der Volleyball den kompletten Spielbetrieb erst am letzten Februarwochenende wieder auf.
Wie verlässlich sind Schnelltests?
Auf den ersten Blick wirken Antigentests einfach. Sie sind schnell, unkompliziert und überall anwendbar. Es sind weder aufwendige Laboranalysen, noch logistische Umwege nötig. Doch wie verlässlich sind diese Schnelltests? In Deutschland hat zuletzt ein Forscherteam um Christian Drosten in einer Studie sieben Antigentests überprüft. Als Probematerial dient ein Nasen-Rachen-Abstich, der nach Übertragen in eine Lösung auf einen Teststreifen aufgetragen wird – und in weniger als 30 Minuten steht das Ergebnis bereit.
Einerseits stellt sich die Frage, ob positive Ergebnisse wirkliche Infizierte nachweisen. Andererseits kommt die Frage auf, ob negative Ergebnisse auch tatsächlich bedeuten, dass man nicht infiziert ist. Unter der Leitung von Drosten ging ein Team der Charité Berlin und der Universität Kiel dieser Frage nach. Die Ergebnisse wurden am 13. November 2020 veröffentlicht.
Dabei spielen zwei Komponenten eine entscheidende Rolle: die Sensitivität und die Spezifität der Tests. Die Spezifität gibt an, wie häufig der Test bei gesunden Menschen negativ ist – die Sensitivität gibt an, wie oft der Test bei Vorliegen einer bestimmten Krankheit positiv ist. Das Ergebnis der Studie war, dass um ein positives Resultat bei einem Antigen-Test zu erzeugen, eine größere Virusmenge notwendig ist als bei der PCR-Testung. Alle Antigentests waren laut den Studienergebnissen jedoch ausreichend genau, um übliche Viruslasten während der ersten Woche mit Krankheitssymptomen zu erkennen.
Ein positives Ergebnis könnte also dabei helfen, über sofortige Isolationsmaßnahmen zu entscheiden. Die analysierten Tests haben laut Autoren außerdem eine relativ geringe Zahl an falsch-positiven Ergebnissen – ist dies der Fall, kann eine PCR zur Ergebnisbestätigung angeordnet werden.
Michael Mina, Epidemiologe an der Harvard Public Health/Medical School, bezeichnete die Studie auf Twitter als „Meisterkurs, wie man Antigen-Schnelltests und ihre Anwendung untersucht und interpretiert“. Diese Antigentests würden „sehr gut funktionieren“, manche jedoch besser als andere. Ein geringes Restrisiko scheint also zu bestehen. „Es geht darum, eine zusätzliche Sicherheit zu verschaffen“, sagt Thomas Dentzer, Virologe der Santé. „Kein einziger mikrobiologischer Test bietet eine hundertprozentige Sicherheit. Die Antigentests haben eine gewisse Spezifität, wie gut sie einen positiven Fall erkennen und eine Spezifität, wie gut sie einen negativen Fall erkennen. Beide Fälle können eintreten. Was häufiger eintritt, ist, dass man einen positiven Fall nicht entdeckt und das ist ein Risiko, dessen wir uns bewusst sind.“
Dentzer sagt, dass die Tests vor allem hochinfektiöse Leute herausfiltern könnten. „Man kann also verhindern, dass hochansteckende Personen am Wochenende auf dem Platz stehen. Bei weniger ansteckenden Leuten kann aber noch das Risiko bestehen, dass sie auf dem Platz stehen. Es gibt noch keine ganz genauen Studien, die belegen, wie stark sich jemand etwa bei einem Zweikampf beim Fußball anstecken kann. Das Risiko, jemanden bei einem Mittagessen anzustecken, ist aber wahrscheinlich höher als beim Fußball. Deshalb wollen wir dieses Projekt auch nutzen, um eine Studie zu erstellen.“
Die Studie soll in den kommenden Monaten veröffentlicht werden. Ob in den kommenden Wochen alle Vereine in der Lage sind, die Vorgaben des Sportministeriums umzusetzen, steht derweil noch in den Sternen. Sportminister Dan Kersch hatte gestern gegenüber RTL gesagt, dass er darüber nachdenke, eine Testpflicht für Sportler einzuführen, die an Wettbewerben teilnehmen. Diese Pflicht könnte frühstens nach dem 21. Februar und mit einem neuen Covid-Gesetz umgesetzt werden. Bis dahin wird es noch eine Menge Diskussionen zu diesem Thema geben.



 De Maart
De Maart



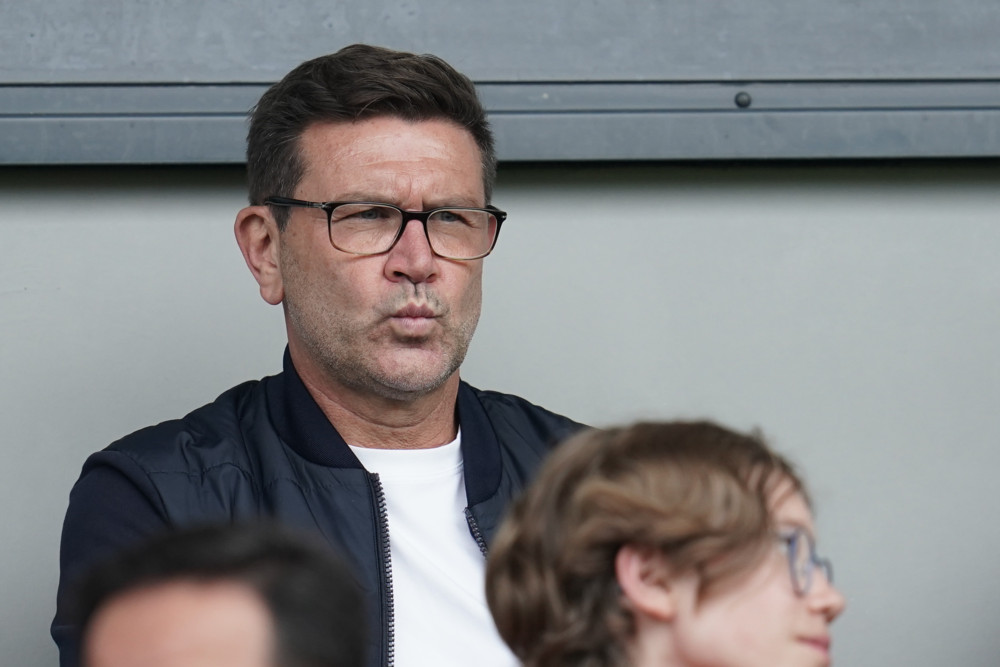



Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können