Man stelle sich vor, der Bürgermeister von Luxemburg und der Chef der Deutschen Bank in Luxemburg würden sich zum „Lunch“ treffen, um über Sponsorship beim Aufbau eines neuen Stadtviertels zu reden und sie würden dies bei … McDonald´s tun. Für Boris Johnson, Bürgermeister von London und Lakshmi Mittal, Hauptaktionär des weltweit größten Stahlkonzerns ArcelorMittal, ist das in diesen olympischen Tagen in London kein Problem. Beide saßen auf dem Olympia Gelände bei besagtem System-Gastronomen und beredeten die Zukunft des Olympia-Stadtteiles.
Das hatte seinen Grund: Lakshmi Mittal stiftete aus seiner Privatschatulle 20 der 22 Millionen Pfund, die ein roter Turm aus ArcelorMittal Stahl neben dem Olympia Stadion kostete. Luxemburg lieferte 900 Tonnen Stahl für das Basement nach London. Der Turm hat sich bereits zu einem Wahrzeichen entwickelt. Und Lakshmi Mittal selbst stand am Eingang und riss Eintrittskarten ab, um die Reaktion der Besucher zu hören.
Man sollte in den Olympia Tagen, die mit den „Olympics“ und den „Paralympics“ insgesamt sieben Wochen dauern, möglicherweise eher mit dem Eurostar aus Brüssel oder Paris nach London fahren. Am Bahnhof St. Pancras zeigt sich, welche Wirkung die Sponsoren haben. Visa sammelt seine Kunden alle 20 Meter auf. Microsoft führt die seinen am Abend zusammen. Adidas führt Kunden und Mitarbeiter mittags in St. Pancras zusammen, rechtzeitig um sie zu der Nachmittags-Session in die Sportstätten zu fahren. Pikant dabei: Der Sponsor Adidas musste akzeptieren, dass die US-Mannschaft mit Nike ausgerüstet ist.
London lebt Olympia
Alleine der Empfang in St. Pancras ist bereits einzigartig: „Welcome France“ oder „Welcome to the french wrestling team“: der gesamte Bahnsteig war mit Empfangsschildern überfüllt für die französischen Ringer, die standesgemäß mit dem Eurostar nach London gekommen waren, für die riesige Mengen Gepäck ausgeladen wurden und dann in den Olympiapark fuhren. London ist derzeit nicht nur Austragungsort der Olympischen Spiele, die ganze Stadt lebt Olympia.
In die Organisation der Olympischen Spiele sind von Beginn an 50 Unternehmen eingebunden worden. ArcelorMittal baute den Turm. Bei einem Mittagessen zwischen Lakshmi Mittal und Jacques Rogge, dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees sei auch überlegt worden, das Olympische Feuer oben auf dem roten Orbit Turm zu installieren. Letztlich hätte dann aber die Zeit nicht mehr gereicht, um die Idee zu realisieren. So steht das Feuer doch erstaunlich klein in einer Kurve des Stadions. Wer in das Stadion kommt, muss es erst suchen. Die Fernsehbilder täuschen erheblich.
14 Milliarden kosten die Spiele
Gute 14 Milliarden Euro kosten die Olympischen Spiele. Elf Milliarden davon kommen aus öffentlichen Kassen. Drei Milliarden bringt das Organisationskomitee auf. Der Staat zahlt seine elf Milliarden aus Steuern, aus Beiträgen der Glücksspiel-Industrie oder auch aus einer Olympia Solidaritätssteuer der Londoner Bürger. Das Organisationskomitee „Locog“ sammelt seine drei Milliarden aus einem 800 Millionen Zuschuss des IOC, der wiederum aus dem Verkauf von Fernseh- und Werberechten stammt, aus dem Verkauf von Tickets und Fanartikeln (etwa 750 Millionen) und aus dem Lizenzverkauf von Unternehmen.
Mc Donald´s hat sein weltgrößtes Restaurant mit 1.500 Plätzen auf dem Olympia Gelände aufgebaut, in dem dann eben auch der Bürgermeister von London und der Hauptaktionär von ArcelorMittal ihren Lunch nehmen. Adidas zum Beispiel zahlt 100 Millionen, um Sponsor werden zu dürfen, McDonald´s 80 Millionen. Coca Cola kaufte für eine unbekannte Summe das Getränke-Monopol. Wirtschaftlich wird der Profit Londons mit etwa einer Milliarde Euro durch Olympia Touristen angenommen. Hotels und Restaurants, aber auch die Fanartikel-Industrie gelten als die großen Gewinner.
Auf der Ausgabenseite der Olympischen Spiele stehen fast sieben Milliarden für die Sportstätten, neue Bahnhöfe und Straßen. Der Olympiapark ist auf einem ehemaligen Industriegelände entstanden. Für die Säuberung der Böden wurden zwei Milliarden ausgegeben, für die Umsiedlung der Firmen eine Milliarde. Auch hier ist an finanzielles Recycling gedacht: Nach den Spielen werden Teile des Parks verkauft.
Sponsoren in Organisation eingebunden
Die 50 Unternehmen, die als Sponsoren auftreten, wurden sehr früh in die Organisation eingebunden. Adidas recycelte zwei Millionen Plastikflaschen zur Herstellung synthetischer Sportkleidung. Das Anwaltsbüro Freshfields erhielt das Monopol für alle Verträge, stellte 40 Anwälte ab und berechnete dafür nicht einen Penny. BMW stellt für die Spiele 200 elektrische Wagen, 400 Fahrräder, Motorräder, elektrische Fahrräder und Hybridwagen bereit. Den Jahrhundertvertrag für die gesamte IT schließlich sicherte sich Atos. Der wesentliche Grund für das Engagement der Formen liegt darin, vor internationalem Publikum weltweit die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu beweisen und sich als Marke vorzustellen.
Dabei bleibt es nicht. Die Besuchergruppen, die über Atos-Schilder oder Adidas oder Microsoft oder… in den Olympiapark geschleust werden, bringen dem Organisationskomitee Hunderte von Millionen ein. Jedes Ticket wird – auch von den Sponsoren – teuer bezahlt. Ein Unternehmen, das am Sonntag, zum Endlauf über 100 Meter Kunden und Mitarbeiter in die Reihen vor die Prinzen William und Harry und Kate platzierte, zahlte pro Ticket 795 Pfund (etwa 1150 Euro) und am Montag zum Stabhochsprung, zum 400 Meter Endlauf und zum Kugelstoßen immer noch bis zu 479 Pfund (etwa 694 Euro).
Unternehmen wie ArcelorMittal hatten für die Olympischen Spiele interne Wettbewerbe ausgeschrieben und eine Jury Mitarbeiter aussuchen lassen, die zu den Spielen jeweils für einige Tage eingeflogen wurden. Das Organisationskomitee hatte für das Tragen der Olympiafackel vor den Spielen den Sponsoren Kontingente zugeteilt. Lakshmi Mittal und vier Mitarbeiter des Unternehmens durften die Fackel tragen. Darunter einer, der einem Kollegen eine Niere gespendet hatte.
Einzigartige Atmosphäre
Die Atmosphäre im Stadion, der Beifall der Zuschauer wenn etwas gelingt, das plötzliche Aufspringen, wenn es spannend wird, der tröstende Beifall bei Tränen und Verzweiflung eines Athleten, die Sympathie bei den Siegerehrungen machen dabei eine einzigartige Atmosphäre aus. Zuschauer und Athleten verschmelzen zu einer Gefühlsgemeinschaft. Gäste der Sponsoren zu sein, bedeutet daher auch, ein besonderes Ereignis und ein besonderes Erlebnis mit den Sponsoren zu verbinden.
Dieses Besondere bringt das Fernsehen nicht herüber. Diese Verbindung des Ticket-Verkaufs an Sponsoren mit Einladung durch Sponsoren ist von der britischen Presse scharf kritisiert worden, weil an den ersten Tagen der Leichtathletik viele Plätze leer geblieben waren, während sich draußen Leute um Tickets bemühten. Am vergangenen Sonntag aber, zum Endlauf über 100 Meter gab es eine Million Bewerbungen um die 80.000 Karten. Und als Usain Bolt am Montagabend zur Siegerehrung ins Stadion kam, standen alle 80.000 des erneut gefüllten Stadions erneut zur Standing Ovation auf.
Mittal zeigt sich offen
Der Hauptaktionär des weltgrößten Stahlkonzerns ArcelorMIttal lebt in London und engagiert sich für London. Lakshmi Mittal hat immer betont, dass er London dafür dankt, freundlich aufgenommen worden zu sein. Der reichste Mann Großbritanniens, als der er betrachtet wird, muss in London nicht eine der Schmähungen befürchten, mit denen er in Florange belegt wird. Mittal zeigt sich in London bei weitem offener, zugänglicher als dort, wo er mit Ablehnung rechnen muss. Zwei Seiten widmet der Evening Standard ihm in einem Gespräch, in dem Mittal auch Persönliches von sich gibt. Der rote Orbit Tower, der abends durch Lichtspiele zu einem lebendigen Turm wird, sollte ursprünglich nur zehn Millionen kosten, erzählt er. Und seine Frau habe mit ihren Wünschen, die er ihr nicht abschlagen konnte, den Preis noch ein wenig erhöht.
Die Kritik daran, dass er das olympische Feuer getragen hat, lässt ihn kalt. Er hat sich einen persönlichen Traum erfüllt, wird in dem Artikel deutlich. Die ganze Familie habe ihn unterstützt sagt er. Das zeigt, dass es sich bei den Mittals um einen Clan handelt. Nicht er alleine hält die Aktien, sondern die Familie. Die Familie ist im Unternehmen tätig. Sohn Aditya ist Finanzchef. Die Tochter Vanisha ist in den Vorstand des Spezialstahlherstellers Aperam eingetreten und ist für die Unternehmensstrategie zuständig.
Lakshmi als Unterstützer des indischen Sports
Er selbst, sagt er, würde seinem Sohn die Freiheit geben, etwas Anderes zu machen, wenn er das wollte. Dafür müsse man als Vater Verständnis haben. Er habe das ebenfalls gemacht und sich über Jahre hinweg zu einem Globetrotter entwickelt. Er glaube aber, dass sein Sohn weiter am Wachstum des Unternehmens mitarbeiten wolle. Lakshmi Mittal gibt in dem Gespräch zu, dass er nicht nur Sponsor von Olympia sei, sondern auch Unterstützer des indischen Sports. Für die Inder reichte es aber nur zu einer Bronzemedaille im Schießen. „Ich bin sehr enttäuscht“, sagt er. Die Förderung des indischen Sports wird er fortsetzen. Bisher hat er acht Millionen Pfund investiert (etwa 11,6 Millionen Euro). Sein Sohn und seine Schwiegertochter, sagt er, seien im sozialen Bereich engagiert und unterstützten ein Hospital. Seine Frau fördere die Kunst und habe in der Serpentine Gallery gerade einen von dem chinesischen Künstler Ai Weiwei entworfenen Saal eingeweiht.
In Großbritannien wird Lakshmi Mittal mit Andrew Carnegie verglichen, der im 19. Jahrhundert in den USA ein Stahlimperium aufbaute. In Europa wäre er „Stahlbaronen“ wie Thyssen, Krupp, Stinnes oder auch Mayrisch vergleichbar. Eine große Familienstiftung wie die Carnegie Stiftung wird aber noch auf sich warten lassen. Er sei noch nicht so weit, zitiert ihn der London Evening Standard. Er sei noch beim Aufbau des Konzerns.
Bürgermeister Boris Johnson hat aber bereits die Zusage, dass sich der indisch-britische Stahltycoon bei der Entwicklung des Londoner Ostens weiter engagieren wird. Nur wird er mit weiteren Spenden wohl noch ein wenig warten müssen.

 De Maart
De Maart






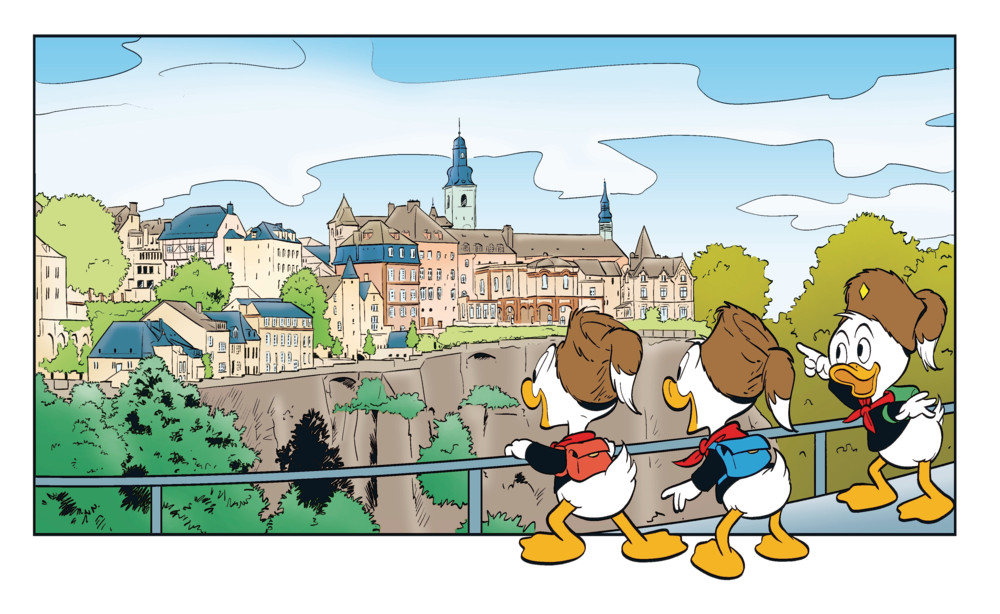


Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können