Einer durfte nicht dabei sein. Justus Ondari von der Daily Nation Newspaper Group in Nairobi in Kenia hatte den Citi Award für Kenia gewonnen. In New York fehlte er. Sein Visum für die Vereinigten Staaten von Nordamerika wurde nicht rechtzeitig erstellt.
Doug Peterson, Chef der Citi Group, hält viel von diesem Journalistenpreis, der der einzige globale ist. Er selbst hat im Rahmen seiner Karriere viel in südamerikanischen Staaten gearbeitet und hat den Journalistenpreis dort in einigen Staaten installiert. Der Grund: Es liegt im Interesse der Wirtschaft, durch solche Preise das Niveau des Journalismus zu erhöhen. Der Citi Preis ist daher nicht, wie andere Preise, mit einem Geldbetrag ausgestattet. Er ist mit einem zehntägigen Seminar an der Columbia University verbunden. Und: die fünftälteste Universität der USA, noch vor den USA selbst von den Briten gegründet, öffnet den Teilnehmern Türen zu großen Finanzinstitutionen und Unternehmen. Der Preis, der an sich schon pro Land den Besten auszeichnet, wird so noch einmal zu einer Auszeichnung durch das Angebot der Universität, aber auch zu einer Herausforderung an die Journalisten.
Herausforderungen
Wir haben zehn Tage auf der guten Seite des Journalistischen gelebt. Wir haben Herausforderungen erfahren, haben Menschen kennen gelernt, die wir sonst nie getroffen hätten. Sicher, es gab Unzulänglichkeiten wie das Hotel. Sicher, die Wall Street behandelte uns wie Touristen, denen man großzügigerweise den Zutritt gestattete. Sicher, die Sicherheitsbeamten vor der FED in New York hatten wenig Lust, uns überhaupt in das Gebäude zu lassen, aber was journalistisch letztlich aus den zehn Tagen in New York geworden ist, hing von jedem einzelnen der 21 Teilnehmer ab. Und dabei war festzustellen, dass es zwar Unterschiede in der Denkweise gab, aber keinen Unterschied in der Neugierigkeit. Die Frage, ob er Morddrohungen erhalten habe, stellte Siaka Momoh aus Nigeria an Tom Torok, den Datenbankchef der New York Times. So abwegig sie schien, war die Antwort ein Schock: Tom Torok hatte sie erhalten. Dies ist nur ein Beispiel dafür, dass diese Gruppe sich mit ihren unterschiedlichen Kulturen ergänzte und jeder auf seine Weise journalistische Anforderungen verkörperte, die über das normale Maß hinausgingen. Jeder war für sich das Beispiel dafür, dass er in seinem Land für guten Journalismus steht.
Wenn wir zehn Tage lang in New York auf der guten Seite des Lebens standen, dann darf man nicht die Augen davor verschließen, dass es viele dunkle Seiten gibt, von denen Armut und Unglück nicht zu übersehen sind. Der Mann zum Beispiel, der in der U-Bahn um Geld bittet, weil ihm als Vietnam-Veteran die Bude ausgebrannt, seine Frau verletzt sei, und er nun nicht mehr weiter wisse. Es ist möglich, dass die Geschichte nicht stimmt. Vom Alter her hätte er Vietnam-Veteran sein können. Aber: Wozu muss ein Mann sich überwinden, um so in der New Yorker Metro zu betteln. Als ich meine Geldbörse nehme und ihm einen Dollar gebe, ziehen viele nach in dem U-Bahn-Wagen. Es ist mir fast peinlich, dass er sich bei mir bedankt.
Säcke mit Plastiktüten
Als wir im strömenden Regen durch den Central Park zur Manhattan-Museumsnacht laufen, werden wir von einer Frau und ihrem Sohn überholt. Sie haben volle Säcke mit Plastikflaschen auf ihren Fahrrädern. Im Frühjahr und im Sommer hat fast jeder New Yorker eine kleine Plastikflasche mit Wasser in der Hand. Der Flüssigkeitsbedarf ist hoch. Am frühen Abend gehen Frauen und Kinder an die Papierkörbe in den Straßen und fischen Flaschen heraus, verkaufen die vollen Säcke zum Recyclen. Das ist die andere Seite des Lebens in New York.
Wenn ich nach New Yorker Zeit morgens um zwei mit Schreiben der Artikel begonnen und Fotos nach Luxemburg gesendet habe, begann der Tag mit einem Gang zu “Big Nick” auf der gegenüberliegenden Seite des Broadways. Der Kaffee zum Mitnehmen kostete 1,25 Dollar. Er war heiß und schmeckte gut. Aber: Dort servierten mir Menschen Kaffee und manchmal auch Frühstück, die an die 70 Jahre alt waren. Da denkt in Luxemburg niemand mehr ans Arbeiten.
Heiß diskutiert wird im Staate New York, was der Gouverneur sich an Sparmaßnahmen überlegt. Dort soll das Rentenalter auf 65 Jahre für die Staatsmitarbeiter angehoben werden. Und neu eingestellte Lehrer sollen nicht schon mit 55 in Rente gehen, sondern erst mit 65.
Der Broadway
Der Broadway ist vom Times Square bis zur 53. Straße die Showstraße. Von der 70. Straße an wird er mehr zur Wohngegend mit kleinen Geschäften. Hier werden dann auch Lücken deutlich, sieht man, wie Patina langsam Besitz von den Häusern ergreift, so wie Patina unser Hotel bereits von außen und innen ergriffen hatte. An der 116. Querstraße liegt die Columbia Universität. Leere Geschäfte gibt es rund um 60. bis 70. Straße. Und früh morgens steht der Menschenhändler auf dem Bürgersteig und verteilt Arbeit für einen Tag. Es ist brutal, wie der eine genommen und der andere gedemütigt weggeschickt wird. Es ist brutal, wie die rauchende Mami, von Plastiktüten umgeben, im Eingang einer Tür sitzend die Menschen um einen “Quarter” (25 Cent Stück) anbettelt.
Das Attentat auf die Türme des Welthandelszentrums hat die Stadt im Umgang mit sich selbst verändert. Bevor man sich einschiffen kann zu einer Tour über den East River, an Staten Island vorbei, steckt man an einem Samstag früh um 10 Uhr gut 90 Minuten in einer Schlange. New Yorker hasten fast immer und gehen auch immer zügig. Aber in Schlangen haben sie eine Geduld, von der selbst Engländer noch lernen können. Die Schlange, die an einem alten Pier beginnt, wird dabei gar nicht von der Kasse verursacht. Sie wird von der Kontrolle bestimmt, der sich alle unterziehen müssen. Das ist wie auf einem Flughafen. Und das dauert. Solche Kontrollen bestimmen den Zugang zur FED in New York und zur NYSE Euronext. Ihr unterziehen sich auch die Börsenmakler, wenn sie rein oder raus gehen, um eine Zigarette zu kaufen. Absperrungen sind normal geworden und die Polizei ist sichtbar. Allerdings selbstverständlich sichtbar und nicht erdrückend, wie in Frankreich. Die Selbstverständlichkeit und auch Freundlichkeit der Polizisten, selbst dann, wenn sie formell werden, fällt auf. Und dennoch: Hier sieht man welchen Freiheitsverlust unsere Gesellschaft hingenommen hat. Möglicherweise war das der eigentliche Erfolg der Attentäter.
Ich mag New York…
Ich mag New York. Ich mag die U-Bahn in New York, die sauber ist und nicht stinkt wie in Paris. Sie rattert mit dem tack, tack, tack meiner Jugend über die Schienen, die nicht – wie in Europa – verschweißt sind. Ich mag dieses Rauschen, mit dem sie sich ankündigt und den Ohren betäubenden Lärm der Expresszüge. Ich mag den Blick von der Promenade des Hudson River auf New Jersey hinüber und die Jogger auf der Promenade. Ich mag das Autofahren in New York, das kurze Hupen, mit dem man sich verständigt. Ich mag New York, weil alles in allem die Menschen hier selbstverständlich und höflich miteinander umgehen. Ich mag New York weil . . .
Es waren tolle zehn Tage mit großartigen Erlebnissen. Der Dank dafür geht an die Jury, die mir den Award zuerkannt hat, an die Citi Finanzgruppe, die ihn ausgeschrieben hat und an zwei Damen der Columbia University: Barbara und Jane, die ihn mit viel Einsatz verwirklicht haben. Thanks to you all.




















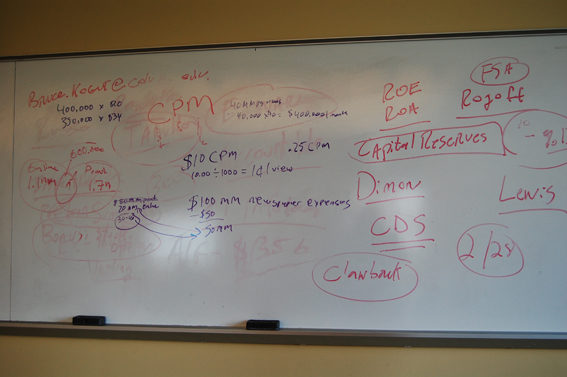















































































































Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können