Sogar Länder des früheren Ostblocks, die anfänglich vom industriellen Strukturwandel profitierten, müssen heute ernüchtert feststellen, dass auch sie nur so lange interessant für die Industrieproduktion waren oder sind, wie sie die von der Wirtschaft gewünschten Bedingungen erfüllen. Ansonsten droht sich das Rad weiterzudrehen, diesmal zu ihren Ungunsten.
Dieser bekannten Entwicklung hat die Politik mit aller Macht versucht, gegenzusteuern. Die industrielle Verödung und ihre Folgen für die Menschen wurden mit finanziellen Mitteln abgefedert, so gut es ging. Das gelang nicht immer, aber es wurde zumindest versucht. Doch alle politischen Anstrengungen scheiterten an einem Punkt: Sie konnten nicht verhindern, dass das soziale Gefüge ganzer Regionen auseinanderbrach.
Statt langjähriger Absicherung und gesicherter Lebensperspektiven waren nun Arbeitslosigkeit, mühsame Arbeitssuche und Ungewissheit angesagt. Dies brachte z.B. mit sich, dass aus früheren Arbeitskollegen plötzlich Rivalen auf dem Arbeitsmarkt wurden. Dabei war es vorher ganz egal, woher der Kollege am Arbeitsplatz kam. Es bewirkte, dass Neid aufkam auf jene, die das Glück hatten, eine Arbeit zu finden. Ganze Familien wurden auseinandergerissen, entweder, weil es die Jugend wegzog, hin zu einem weit entfernten Arbeitsplatz, oder weil sie einfach nur der Tristesse entfliehen wollte, die inzwischen vielerorts dort herrscht, wo früher Leben pulsierte. Sich seit Generationen abspielende soziale Abläufe kamen zum Stillstand.
Nicht nur Länder im Osten
Als nächstes kam die Finanzkrise, die in noch rasanterem Tempo weitere, tiefgreifende Einschnitte nötig machte. Lohn- und Gehaltskürzung sind die Folge, die soziale Abfederung wird ausgehöhlt.
Viele Menschen haben wegen dieser grob geschilderten Entwicklung des wirtschaftlichen Geschehens der letzten Jahrzehnte Probleme. Sie finden sich nicht mehr zurecht zwischen den einstigen, gesicherten eigenen Vorstellungen vom Leben und der heutigen Realität. Angesichts eines solchen Wertverlustes beginnen die Suche nach Sündenböcken und das verzweifelte Festklammern an jenen Dingen, die sich nicht verändert haben. Und hierzu gehört die Nationalität.
Es ist, so gesehen, wohl kaum ein Zufall, dass von den 16 in Europa etablierten rechtsextremen Parteien deren zehn eine Referenz auf die Nationalität ihres Landes in ihrem Namen angeben. Das reicht von einer „Großrumänischen Partei“ über die „Wahren Finnen“ bis hin zur „Dänischen Volkspartei“ und den „Schwedendemokraten“, die jetzt den Eintritt ins schwedische Parlament geschafft haben.
Es sind also nicht nur Länder im Osten, die betroffen sind. Dort kommt natürlich hinzu, dass sich viele beim Beitritt zur EU z.B. eher eine Festigung der neu gewonnenen Freiheit anstatt einer neuen Art der Bevormundung gewünscht hätten – und als solche betrachten viele das EU-Regelwerk. Man ist wieder wer, man will es bleiben. Auch wenn man nun mit seiner Freiheit rumsitzt und nicht viel davon hat.
Einer solchen Entwicklung ist schwer beizukommen. Denn sobald es um die Wahl geht, Europäische Union oder Nationalstaat, werden die Nationalstaatler in jetzigen Zeiten die Oberhand gewinnen. Für die EU ist es daher wichtig, nicht als eine Art anti-nationales Gebilde wahrgenommen zu werden.
Ein Ansatz sind die europäischen Außendienststellen, die jetzt geschaffen werden. Wenn alle EU-Bürger bei Problemen im Ausland nicht ihre nationale Botschaft z.B. aufsuchen müssen, sondern sich an die EU-Vertretung wenden können, die sich um ihr Problem kümmert, kann es die Chance geben, die EU wieder zu festigen. Das muss keine Abstriche auf Länderebene bedeuten. Auch ein US-Bürger kommt aus einem US-Staat und ist stolz auf dessen Eigenheiten. Außerhalb der USA jedoch ist er nur eins: ein Bürger der Vereinigten Staaten. Angesichts der aktuellen Entwicklung jedoch bleibt zu befürchten, dass eine solche EU-Identität noch lange auf sich warten lässt.
Serge Kennerknecht
[email protected]

 De Maart
De Maart


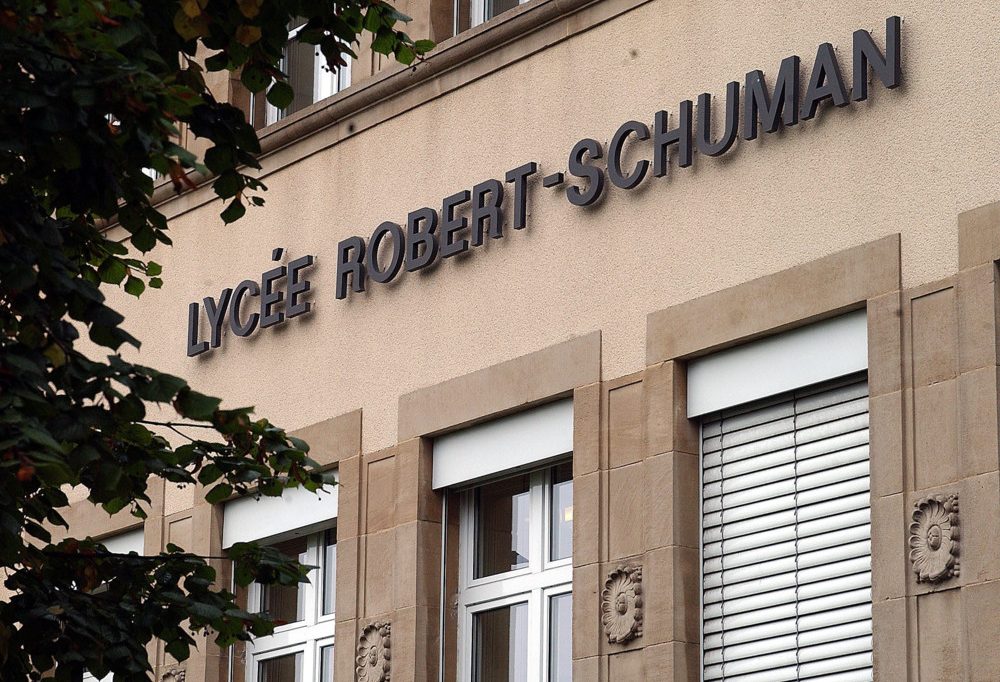



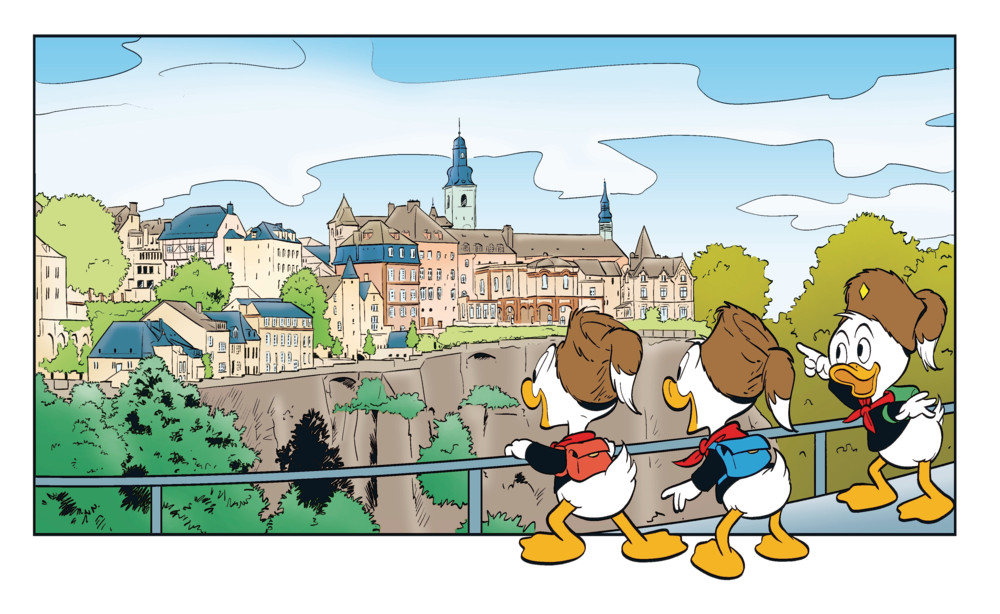
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können