Es ist ein doch eher ungleiches Paar, das die Onlinewelt regiert. Denn
neben Katzen thront die Pornografie. Beide Inhalte erfreuen sich großer Aufmerksamkeit, die wohl alsbald nicht nachlassen wird. Während der Konsum von Katzenbildern tendenziell nicht als schädlich angesehen wird, verhält es sich mit der jahrtausendealten Darstellung von sexuellen Akten etwas anders.
Von Anne Schaaf
Genau deswegen ist eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema Pornografie vonnöten, denn ob man sie sich nun zu Gemüte führt oder (behauptet, dies) nicht (zu tun), wird man auf die eine oder andere Art und Weise mit ihr konfrontiert. Dafür braucht es nicht einmal einen Computer, pornografische Inhalte gelangen auch über Umwege durch Filme, Literatur, Musik und Medien jedweder Art an den Mann, die Frau oder gar das Kind.
In der öffentlichen Debatte wird Pornografie nicht selten gehasst, gefürchtet oder für den Untergang des Abendlandes verantwortlich gemacht. Diese Meinungskakofonie hat jedoch einen etwas ironischen und ebenso gefährlichen Haken. Über was man da genau diskutiert, ist nämlich häufig unklar.
In diesem Kontext fühlt man sich an den amerikanischen Richter Potter Stewart erinnert, der in den 60ern im Rahmen eines Prozesses seine Einschätzung zu der etwaigen Obszönität eines Spielfilms geben sollte. Er gestand zwar, dass es keine juristische Definition des Begriffes „Hardcore-Pornografie“ gebe, jedoch fügte er hinzu: „Aber ich erkenne sie, wenn ich sie sehe.“ Obwohl jedem seine eigene Meinung zum Thema zusteht, ist es riskant, sogar den Streitgegenstand individuell zu definieren, denn dann ist das diskursive Chaos programmiert.
Verwirrende Begrifflichkeiten
Noch in den 1970ern führte man in der Bundesrepublik unter dem Begriff „Pornografie“ Darstellungen, welche die im Einklang mit den gesellschaftlichen Wertvorstellungen gezogenen Grenzen des sexuellen Anstands eindeutig überschreiten. Wer in luxemburgischen Gesetzen stöbert, sieht pornografische Produktionen in einer Reihe mit „incitatrices à la violence ou à la haine raciale“ und „apologétiques de crimes contre l’humanité“. Eine etwas verquere Juxtaposition, die halsbrecherische Pauschalisierungen erahnen lässt, beachtet man, dass der Begriff nicht wirklich vom Gesetzgeber definiert wird.
Nun stoßen allein schon in diesen Beispielen neue Begriffe und Themenfelder aufeinander, die einer differenzierten Analyse bedürfen. Laut großherzoglicher Gesetzgebung werden Werke „contrevenant à l’ordre public et aux bonnes moeurs“ auf die stille Treppe verwiesen, es gestaltet sich indes äußerst schwierig, in einer modernen pluralistischen Gesellschaft die sogenannten „gesellschaftlichen Sitten“ auf repräsentative Art und Weise fassbar zu machen.
Was ist Ebenso dürfte es nicht allzu leicht fallen, heutzutage noch ein festes, allgemeingültiges Raster auf einen Begriff wie „Anstand“ zu legen und im Detail juristisch festzuhalten, was denn nun die öffentliche Ordnung durcheinanderbringt und was nicht.
All dies bedeutet, dass lange bevor überhaupt über eine potenzielle Schädlichkeit von Pornografie gesprochen werden kann, erst eine konsensfähige Definition her muss, wenngleich sie derzeit fehlt. Diese mangelnde Übereinkunft kann eventuell mit einem Blick in die Forschung erklärt werden.
Pornografien
Die Historikerin und Genderforscherin Lynn Hunt verweist darauf, dass erst durch die historische Perspektive die Funktion von Pornografie in der modernen Kultur nachvollziehbar wird. Diente sie zwischen 1500 und 1800 oftmals als Vehikel, um politische und religiöse Autoritäten zu kritisieren, so tut sie dies heute sicherlich noch in Teilen, aber mittlerweile kamen viele andere (auch unpolitischere) Funktionen hinzu. Laut Hunt hat man es somit bei der Pornografie nie mit einem „gegebenen Tatbestand“ zu tun. Was auf wissenschaftlicher Ebene zumindest als gesichert gelten kann, ist, dass es im Laufe der Geschichte nie nur eine, sondern viele verschiedene Pornografien gab.
Umso mehr erstaunt es, dass Alice Schwarzer im Rahmen ihrer bekannten PorNO-Kampagne Ende der 1980er forderte, die Pornografie in Deutschland gänzlich zu verbieten. Sie unterbreitete 1987 den damaligen Bundestagsabgeordneten einen Gesetzentwurf samt Begründung, in der es unter anderem hieß, Pornografie sei gewissermaßen „Rassenhass“ und propagiere Volksverhetzung gegen Frauen. Zudem bestimmte sie im Alleingang den Betroffenheitsgrad.
Sodass auch Frauen, die nicht gegen Pornografie waren, ihrer Auffassung nach zur Kategorie der Opfer gehörten, „ob sie wollen oder nicht“. Die wohl am stärksten mediatisierte Feministin Deutschlands verkündete im gleichen Zeitraum: „Wir wissen alle, dass wir frei sein werden, wenn es keine Pornografie mehr gibt.“
Obwohl sich gerade Schwarzer häufig gefährlich verkürzender Aussagen bediente und nicht unbedingt für differenzierte Analysen einstand, so kann man weder ihr noch anderen Pornografie-Gegnern und -Gegnerinnen vorwerfen, dass sie sich gegen ein fiktives Problem stellten. Auf dem weltweiten Pornografie-Markt kursierten (und kursieren bis heute) Filme, die an Menschenverachtung kaum zu überbieten waren und unter unwürdigen Arbeitsbedingungen erzeugt wurden.
Nichtsdestotrotz wurde in der damaligen und wird in der heutigen Streitdiskussion fast immer ein essenzielles Element außer Acht gelassen: Es gab, gibt und wird immer Pornografien geben, die sich durch Grenzüberschreitung, Gewalt und mangelnden Respekt gegenüber unterschiedlichsten Geschlechtern auszeichnen. Dies liegt nicht am Genre selbst, sondern daran, dass es, solange menschenverachtende Haltungen existieren, auch Darstellungen von eben diesen geben wird. Pornografie ist nur eine Möglichkeit der Transposition inhumaner Gedanken. Sie ist ein mögliches Medium, aber nicht die Botschaft selbst.
Es gibt aber auch Bewegungen, Gruppen sowie einzelne Akteure, die sich mit einem klaren „PorYES“ positionieren und andere, positive Inhalte vermitteln wollen. „PorYES“ ist beispielsweise der Name eines Awards, der in Berlin verliehen wird und Produzenten sowie Produzentinnen prämiert, die innovative Kontrapunkte zur nicht immer, aber schon sehr häufig sexistischen Mainstream-Pornografie setzen, die Geschlechterstereotypen nicht selten zementiert, statt sie in Frage zu stellen. Bei diesem bekennend feministisch ausgerichteten Projekt werden Produktionen ausgezeichnet, „die vielfältige sexuelle Ausdrucksweisen weiblicher Lust zeigen und in denen Frauen bei der Filmproduktion maßgeblich beteiligt sind“.
Ein wichtiges Stichwort ist hierbei die sogenannte „Sexpositivität“, die unter anderem besagt, dass einvernehmliche sexuelle Aktivitäten zwischen Erwachsenen keiner Regelung und keiner Bewertung bedürfen. Durch die Anerkennung und die anschließende Bekanntheit sexpositiver Darstellungen wird ein Wandel der derzeitigen Sex- und Erotikkultur angestrebt. Der sexuelle Akt soll nicht schambehaftet sein, sondern mit Wohlbefinden assoziiert werden. Eine hervorzuhebende Rolle spielen Sensibilisierung und Information, anhand derer in der Folge einvernehmlicher Safer Sex stattfinden kann.
Wichtige Grundvoraussetzungen für Pornos dieser Machart sind beispielsweise das Einhalten von im Voraus abgesprochenen Grenzen und ethische Arbeitsbedingungen. Charakteristisch für sexpositive Pornos ist unter anderem die Darstellung von Emotionen und diversen Formen des zwischenmenschlichen Austauschs, so kommt neben Berührungen auch Augenkontakt hinzu. Ebenso spielt die Vielfalt der Kamera-Einstellungen eine Rolle. Gezeigt werden längst nicht nur Genitalien oder Körperöffnungen. Die Filme tragen der Tatsache Rechnung, dass es bei gutem Sex um weitaus mehr geht.
Keine Einbahnstraße
Hier soll Sex kein Extremsport, sondern vielmehr eine realistische Abfolge von Zärtlichkeit sein. Der Genuss und die Lust aller Betroffenen stehen im Fokus. Relevant ist vor allem auch Vielfalt auf der Ebene der Körpertypen, Altersgruppen, des ethnischen Hintergrunds und auch in Bezug auf die sexuelle Orientierung. Stereotypen werden aufgebrochen und neu gedacht.
Man merkt schnell, dass Sex in diesem Kontext durchaus auch politisch gesehen wird, daher wundert es wenig, dass bekannte Produzentinnen wie Erika Lust (sie ist ebenfalls studierte Politikwissenschaftlerin) oder Jennifer Lyon Bell (die sich auf Slow Porn spezialisiert hat) sich auch an politischen wie wissenschaftlichen Debatten beteiligen.
Die Themen Sex und Sexualität finden sich in vielen verschiedenen Formen und Darstellungen wieder, da sie auf die eine oder andere Art und Weise den Alltag eines jeden Menschen ausmachen. Es gibt so viele verschiedene Arten des Storytellings, wie es individuelle Gelüste, Fantasien und Bedürfnisse gibt. Gerade im Bereich der Pornografie lässt sich dies an einem stetig wachsenden Sortiment ablesen, das sich zumindest in Teilen von althergebrachten Klischees löst.
Falls man in dieser Fülle an „Geschichten“ auf Darstellungen stoßen sollte, die man für besorgniserregend und gesellschaftsschädlich hält, so wäre es absurd, lediglich das Medium zu hinterfragen und zu verbannen. Das käme der Abschaffung von Lastwagen gleich, weil diese in letzter Zeit mit Vorliebe von Terroristen benutzt werden.

 De Maart
De Maart




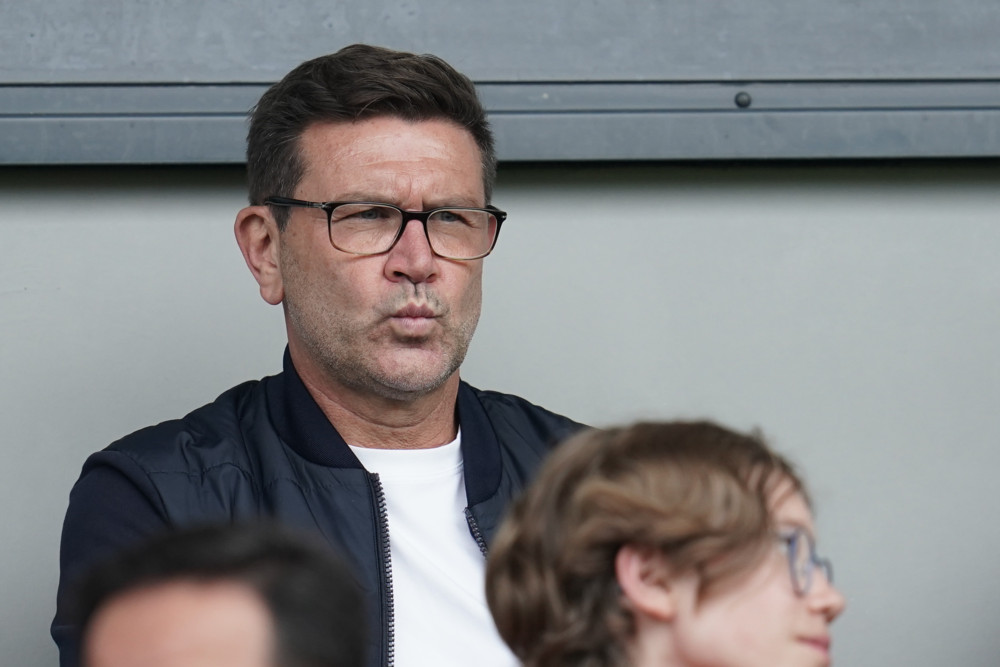



Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können