„Die beste Form der Rache? Rache!“ – Unter diesem Credo stellt der Auschwitz-Überlebende Meyer Offermann (Al Pacino) eine Nazijägertruppe auf die Beine, um im Amerika der 1970er-Jahre untergetauchte NS-Verbrecher aufzusuchen und umzubringen. Jüngstes Mitglied des Rächerclans ist der jüdische Teenager Jonah Heidelbaum (Logan Lerman), der allerdings mit den Foltermethoden seiner Kollegen hadert.
Anders als Meyer Offermann hat Jonah den Zweiten Weltkrieg nicht am eigenen Leib erfahren. Die Gräueltaten der Nazis entziehen sich seiner Vorstellungskraft, stattdessen gehört Jonah einer Generation an, die von Rockmusikern und Superhelden träumt. Dennoch läuft Jonahs Familiengeschichte unweigerlich mit der des Holocausts zusammen: Seine Großmutter Ruth hat an der Seite von Meyer Offermann Auschwitz überlebt. Mittels Rückblenden erzählt Offermann das im KZ erlittene Unrecht nach und macht die Monstrositäten für Jonah somit erstmals greifbar.
Eine solche Rückblende ist es auch, für die „Hunters“ massiv in Kritik geraten ist: Die Rede ist von einem Schachspiel mit KZ-Insassen als menschliche Figuren, die sich gegenseitig die Kehlen aufschlitzen müssen. Die Gedenkstätte Auschwitz kommentierte die Szene auf Twitter umgehend als eine „gefährliche Dummheit“, die sich so nie zugetragen hätte und somit Holocaust-Leugnern in die Karten spiele. Zahlreiche Rezensenten warfen der Serie vor, den Holocaust zur Unterhaltungsware verkommen zu lassen. Das endgültige Urteil schien damit besiegelt, die Serie als geschmacklos abgetan. Ist das gerechtfertigt? Denn was in der Diskussion nur wenig beachtet wurde, ist die Reaktion des Serienschöpfers David Weil auf die Kritik.
Was darf Kunst?
Wie sein Serienheld Jonah ist auch David Weil der Enkel einer KZ-Überlebenden. Weil mag den Holocaust zwar nie erlebt haben, aber ein Außenstehender ist er nicht. Stattdessen gehört er einer Nachfolgegeneration an, die mit den familiären Traumata der Schoah aufgewachsen ist, ohne diese jedoch am eigenen Körper erfahren zu haben. Einer Generation, die betroffen ist, ohne betroffen zu sein, und deren Selbstverständnis von Erinnerungen geprägt ist, die nicht die eigenen sind.
Die Literaturwissenschaftlerin Marianne Hirsch führte 1997 den Begriff „postmemory“ ein, um jene innerliche Zerrissenheit der Nachfolgegeneration festzuhalten. Damit sprach sie auch eine damalige Leerstelle im Holocaust-Diskurs an: Welche Rolle spielen die zweite und dritte Generation in der Aufrechterhaltung und Vermittlung eines kollektiven Gedächtnisses? Ihre Erinnerungen sind Repräsentationen der Erlebnisse der ersten Generation, gründen auf Erzählungen und Bildern und lassen die Grenzen zwischen Faktizität und Imagination verschwimmen.
Keine Dokumentation
Eine authentische Geschichtsschreibung steht damit nicht in ihrer Macht. Mit diesem Anspruch sollte ihr Wirken aber auch nicht gemessen werden, denn dafür gibt es Historiker. Stattdessen können die Nachfolgegenerationen zu den Stützen eines kollektiven Gedächtnisses heranwachsen, welches medial vermittelt wird. Die Inszenierung von Geschichte – oder auch: die kreative Aufbereitung von (Post-)Erinnerungen – ist ein essenzieller Baustein der Erinnerungskultur der Moderne: Filme wie „Schindlers Liste“ oder Art Spiegelmans Comic „Maus“ mögen nur Repräsentationen des Holocausts sein, sie haben jedoch maßgeblich zur Aufklärung und Popularisierung der „Nie wieder!“-Maxime beigetragen.
Als eine solche Repräsentation sollte man nun auch „Hunters“ betrachten: „Es ist keine Dokumentation und es sollte auch nie eine sein“, entgegnete David Weil auf den Vorwurf der Fiktionalisierung. Weil er keine tatsächlichen Traumata konkreter Personen in seiner Serie verarbeiten wollte, habe er versucht, eine symbolische Darstellung für die Gewalt in den Lagern zu finden.
Damit betreibt die Serie auch keinen Geschichtsrevisionismus, denn die Grausamkeit der Nazis ist das Fundament, auf dem sowohl „Hunters“ als auch die tatsächliche Massenvernichtung der Juden gründen. Die Schachbrettszene darf daher nicht als Verfälschung verstanden werden, sondern vielmehr als eine Allegorie auf die Bestialität der Nazis.
Nazis als Geheimwaffe
Inhaltlich erinnert Hunters stark an Tarantinos Nazijägerfilm „Inglourious Basterds“. Dadurch, dass die Serie in der Nachkriegszeit angesiedelt wurde, geht „Hunters“ in seiner Nazikritik jedoch über das bloße Anprangern des NS-Regimes hinaus. Stattdessen geht es um die gescheiterte Aufarbeitung danach und um jene internationalen Versäumnisse, unter denen zahlreiche ranghohe SS-Offiziere nach dem Zweiten Weltkrieg ungestraft davonkommen konnten.
Während die Selbstjustiz bei Tarantinos Nazijägern somit als Rächer- und Gewaltfantasie interpretiert werden kann, wird sie bei Weil zu einer notwendigen Bedingung für Gerechtigkeit. Hunters legt den moralischen Verfall der USA frei, unter dem etliche Nazis untertauchen konnten: Da wären zum Beispiel die US-Geheimdienste, die im Kalten Krieg hunderte NS-Wissenschaftler für die amerikanische Weltraumforschung rekrutiert haben.
Im Gegensatz zur Schachbrettszene wird hier nicht nur eine Repräsentation der Wahrheit angestrebt. Die sogenannte „Operation Paperclip“ gab es tatsächlich, die Schuld der USA ist unbestreitbar. Dass „Hunters“ diese realpolitischen Vergehen zur Sprache bringt, muss man der Serie hoch anrechnen. Darüber hinaus versucht die Serie, die Brücke zum modernen Rassismus zu schlagen. Indem sich eine Afroamerikanerin und ein vietnamesischer Kriegsveteran der Nazijagd anschließen, werden auch deren Ausgrenzungserfahrungen angesprochen. Den USA wird der eigene Rassismus vor Augen geführt, indem ihr der Status als unbefleckte Befreier-Nation abgesprochen wird.
Keine ausgereiften Spannungsmomente
Nichtsdestotrotz weist die Serie zahlreiche Mankos auf: Es scheint, als hätte sich David Weil mit „Hunters“ zu viel auf einmal vorgenommen. Da werden Sozialkritik, Humor, dystopische Elemente und Splatterszenen in einen Topf geworfen, reihenweise popkulturelle Referenzen getätigt und es wird versucht, den Zeitgeist der 70er-Jahre heraufzubeschwören. Darunter leidet letztendlich vor allem die Handlung, deren Aufbau oftmals erzwungen wirkt.
Das zeigt sich insbesondere in Jonahs Charakterentwicklung, der angesichts der Grausamkeiten, die seine Großmutter im KZ erleben musste, zunehmend seine moralischen Bedenken abwirft. Dass es jedoch nur eine einzige Folge benötigt, um Jonah in einen spektakulären Kampfsportler zu verwandeln, grenzt an Absurdität. Konflikte werden zu schnell und unbeholfen gelöst, sodass es zwar viele Spannungsmomente gibt, aber keiner tatsächlich ausgereift ist.
Der stärkste Standpunkt der Serie ist ihre Haltung: Sie scheut sich nicht davor, den Holocaust in seiner Grausamkeit darzustellen und aufzuarbeiten. Dass ihr genau das vorgeworfen wird, ist kurios.

 De Maart
De Maart


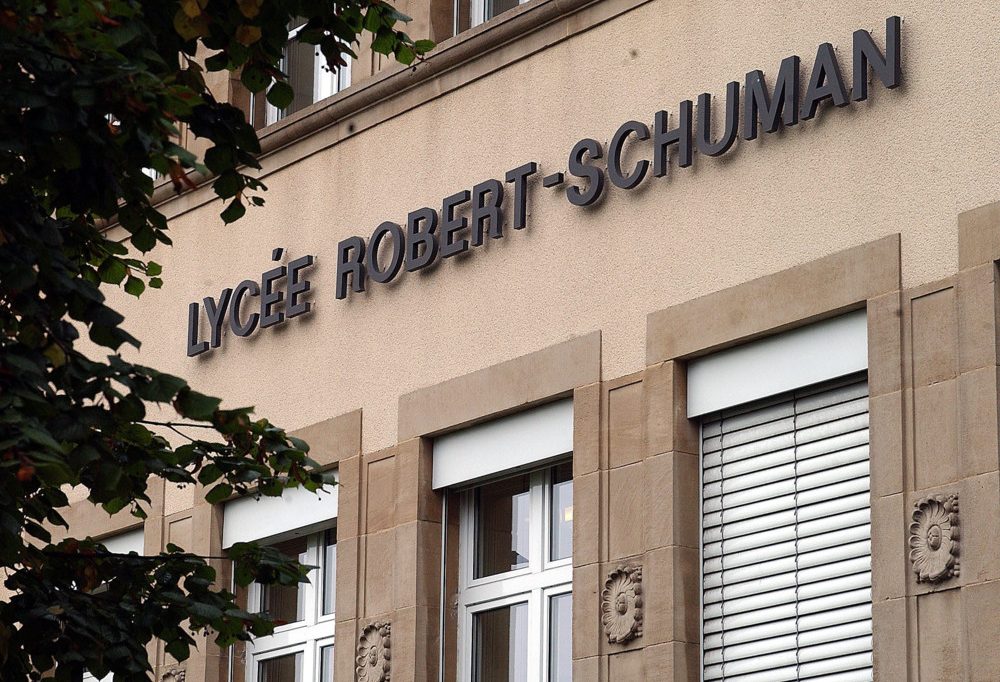



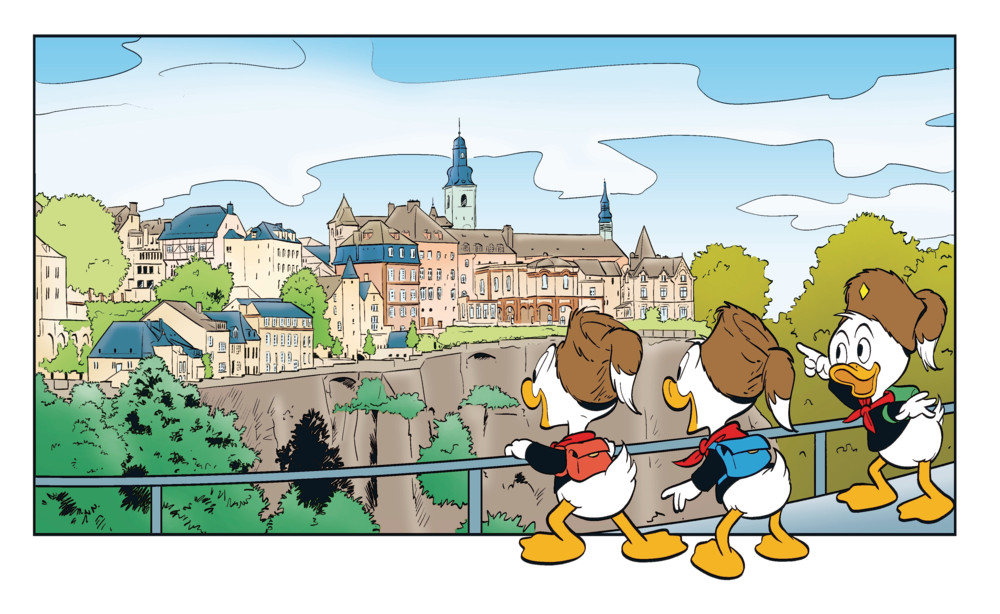
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können