Ainhoa Achutegui schreibt über diskriminierende Sprache – und macht sich diesmal Gedanken, wie universell „Hautfarbe“ überhaupt sein kann…
Von Ainhoa Achutegui
Letztens stieß ich auf Twitter im Kontext von #wörterdiewegkönnen auf den Begriff „Hautfarbe“. Das Hashtag sammelt Wörter, die diskriminierend sind und aus dem Sprachgebrauch hoffentlich bald verschwinden. Da tummeln sich Ausdrücke wie „Milchmädchenrechnung“, „Mannsweib“, „Fräulein“ und eben „Hautfarbe“ als Farbbezeichnung. Es handelt dabei um eine helle Färbung zwischen beige, rosé und perlfarben, die „unserem“ Hautton entsprechen soll. Wenn ich allerdings meine Haut anschaue, so bemerke ich, dass sie um einiges beiger bzw. gelblicher als „Hautfarbe“ ist. Unter „uns“ Weißen finden wir Hunderte Nuancen von Teint vor: Manche Menschen sind gelblicher, manche mehr rosa, andere wiederum sehr hell, viele sind gelb/orange. Keine Hautfarbe ist gleich, trotzdem nennen wir einen bestimmten beigen Ton, den vielleicht manche auch tatsächlich haben, „hautfarben“.
Was empfindet eine Person mit dunklerer Hautfarbe, wenn sie beim Suchen nach der geeigneten Unterwäsche im Internet auf den Begriff „Hautfarbe“ stößt? Kann sie sich damit identifizieren? Manche werden meine Kritik an Ausdrücken wie „Hautfarbe“ als Übertreibung und Überstrapazierung des politisch Korrekten empfinden; ist sie aber nicht, wenn man in einer Gesellschaft aufwächst, die wenig Diversität im Spielzeugregal, in den Medien oder in der Werbung aufweist. In den Spielsets der Hersteller wie Lego oder Playmobil bleiben die meisten Figuren „weiß“ (bzw. gelb). Mittlerweile gibt es bei Playmobil zwar schon Forscherinnen und Ärztinnen, doch die dunkleren Figuren sind immer noch dünn gesät. Und wenn, dann sind sie nicht unbedingt die Helden und Heldinnen, mit denen sich die Kinder identifizieren wollen, sondern oft dunkelhäutige „Randfiguren“. Ein Kind mit dunkler Hautfarbe möchte wie alle anderen Lillifee oder Drachenfänger sein.
In vielen von jungen Frauen hausgemachten Schminktutorials auf YouTube lernen wir z.B., dass bei der Make-up-Grundierung darauf geachtet werden soll, immer „zwei Töne“ unter dem eigenen Teint zu applizieren. Wie kommen junge Menschen zu so einer Auffassung? Hatten wir das Thema des Weißer-aussehen-Müssens nicht längst mit Michael Jackson überwunden? „Alltagsrassismus“ bezeichnet diese unterschwellige Diskriminierung, die sich in Sprache, Kommentaren und Witzen wiederfindet und junge Frauen mit Migrationshintergrund zu fragwürdigen Schminkempfehlungen verleitet.
Wenn pseudowissenschaftlich argumentierter Rassismus wie die White-Supremacy-Ideologie an Terrain gewinnt und rechtsextreme Parteien auf dem Vormarsch und wir uns hoffentlich einig sind, dass sie gestoppt gehören, dann muss auch der Alltagsrassismus beseitigt werden. Die „Negerküsse“ – in Österreich gab es obendrein „Negerbrot“-Schokolade – sind unter dieser Bezeichnung glücklicherweise mittlerweile aus den Supermarktregalen verschwunden; die österreichische Süßspeise „Mohr im Hemd“ und das „Zigeunerschnitzel“ befinden sich im deutschsprachigen Raum noch in vielen Gasthäusern auf der Speisekarte.

 De Maart
De Maart



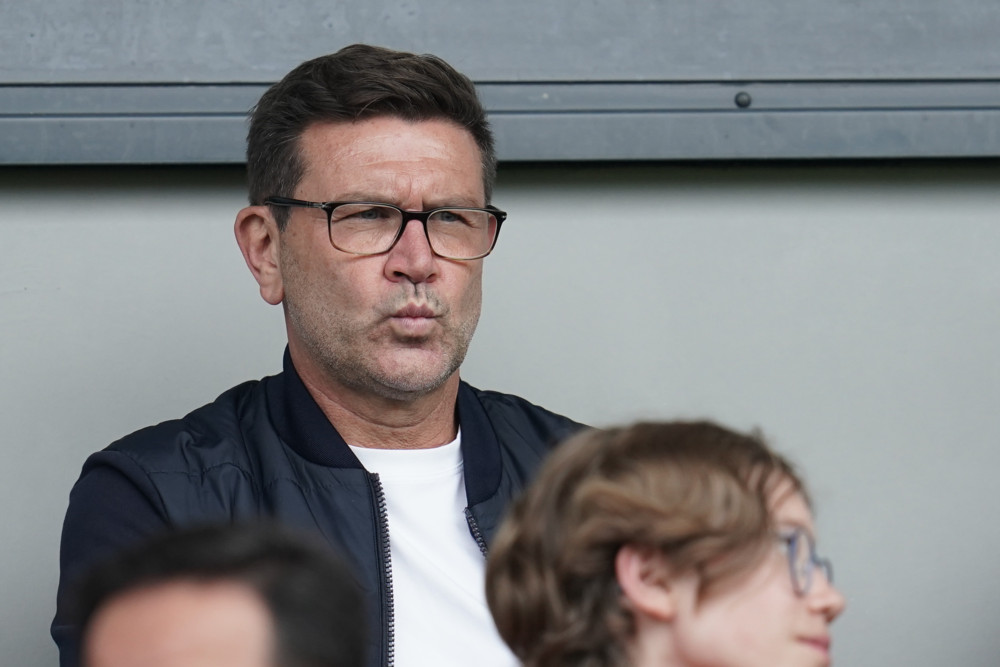



Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können