Die öffentliche Aufmerksamkeit ist Maria Carmen D’Onza und ihrem Team gewiss: Die Archäologinnen graben auf der Liegewiese im Trierer Palastgarten, vor den Augen von Sonnenanbetern, Spaziergängern, Touristen. Zuschauen kann da jeder, wenngleich ein Zaun für den nötigen Sicherheitsabstand sorgt. Aber wie war das vor 17 Jahrhunderten, als sich hier, zwischen Konstantin-Basilika und Kaiserthermen, der Palastbezirk erstreckte, die Machtzentrale des Weströmischen Reiches? War das Regierungsviertel tabu oder durfte das „gemeine Volk“ hier ebenfalls flanieren? Genau dieser Frage geht die Grabung nach, ein Projekt der Technischen Universität (TU) Darmstadt in Kooperation mit der Trierer Außenstelle der Landesarchäologie, die nur einen Steinwurf entfernt am Rheinischen Landesmuseum angesiedelt ist.
Federführend ist Dr. Maria Carmen D’Onza, frühere wissenschaftliche Mitarbeiterin des Landesmuseums und seit zweieinhalb Jahren in der Klassischen Archäologie des Fachbereichs Architektur der TU Darmstadt tätig. Die Sondage-Grabung gehört zu ihrem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanzierten Projekt „Restricted Area oder Interaktionsraum zwischen Kaiser und Civitas? Wegeführung und Erschließung der Trierer Kaiserresidenz.“ Gesucht wird auf einer relativ kleinen Fläche nicht nach römischen Schätzen, sondern vorrangig nach Gebäuderesten – und einer Straße.
Was sich die Forscher von den Grabungen erhoffen
„Wir wissen, dass sich unter dem Stadtarchiv eine antike Ost-West-Straße befand“, sagt die 39-jährige Wissenschaftlerin. Wenn man diese Verkehrsverbindung auch an der knapp hundert Meter entfernten Grabungsstelle nachweisen könne, dann sei das ein Beleg für die öffentliche Zugänglichkeit des Palastbezirks. Erwartet würden neue Details zur baulichen Gestaltung und Nutzung des Areals, auf dem sich bisher erst ein einziges Mal Archäologen getummelt haben: 1888, als auf dem Palastgarten-Terrain Kanalisationsrohre verlegt wurden und Altertumsforscher baubegleitend mit von der Partie waren. Bereits damals habe es römische Befunde gegeben, aber eben auch nur auf einer kleinen untersuchten Fläche.
Seither ist es ein Archäologen-Wunschtraum, einmal im Palastgarten buddeln zu dürfen und dabei mehr über Konstantin & Co. erfahren zu können. Für Maria Carmen D’Onza geht er dank ihres Forschungsprojekts zumindest in kleinem Stil in Erfüllung. Denn das Projekt ist nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich knapp bemessen: „Bis zum 7. April wollen wir fertig sein und die ausgehobene Grube wieder zuschütten.“
Was weiß man schon über das Palastgarten-Areal?
Für Spannung ist gesorgt. Denn der Palastgarten ist ein großer weißer Fleck auf dem Stadtplan des römischen Trier. Das Areal des heutigen Stadtparks wurde seit dem 17. Jahrhundert erst als kurfürstliche Gartenanlage, später als Exerzier- und Fußballplatz genutzt. Die Kenntnisse davon, wie es einst unter der heutigen Erdoberfläche, die gut zwei Meter über dem Niveau liegt, auf dem sich einst die Imperatoren bewegten, sind noch minimal. Die aktuelle Grabung soll das ändern. Die neuen, teilweise bei Georadar-Untersuchungen im vergangenen Jahr gewonnenen Daten werden laut Maria Carmen D’Onza „in ein eigens dafür angelegtes Geoinformationssystem eingepflegt. Sie werden mit den bereits vorhandenen archäologischen Dokumentationen abgeglichen und sollen die fehlenden Puzzlesteine für eine umfassende Auswertung der Wegeführung und Gestalt der Kaiserresidenz im vierten Jahrhundert sein.“

 De Maart
De Maart



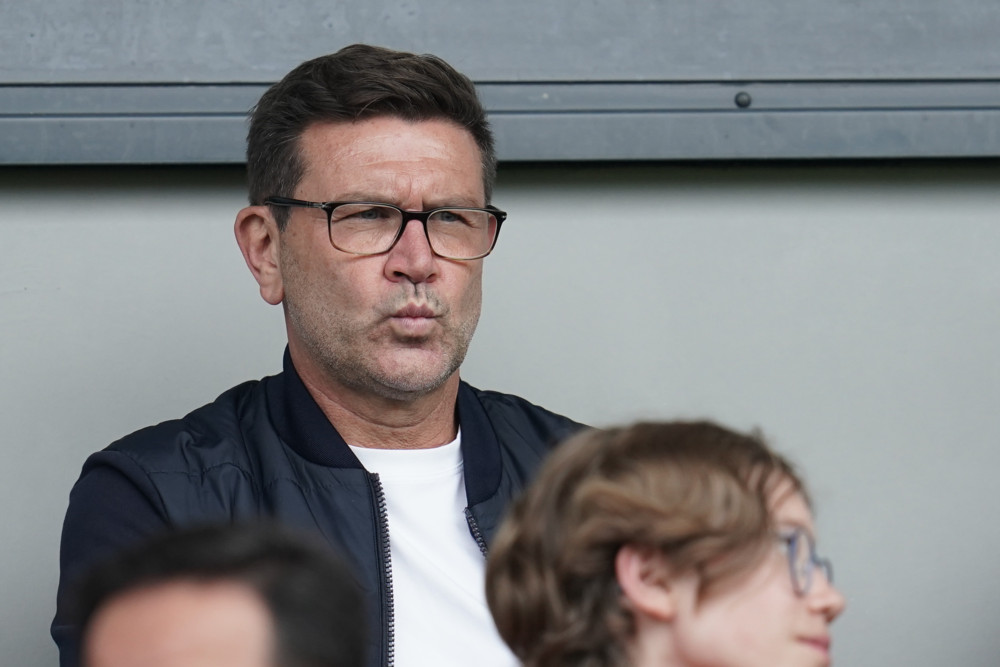



Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können