Die diesjährige Shortlist des Booker Prize bewirbt alles andere als Wohlfühl-Literatur: Alkoholsucht, Postapokalypse, Rassismus, Depression und Demenz sind nur einige der zentralen Themen, die in den sechs auserkorenen Werken verhandelt werden. Aber selbst inmitten einer Shortlist, in der ein Roman mit einer Totgeburt beginnt („The New Wilderness“ von Diane Cook), kann man Avni Doshis Debüt als eines der verstörenderen Werke gelten lassen.
„Burnt Sugar“ beginnt mit einem Eingeständnis: „I would be lying if I said my mother’s misery has never given me pleasure. I suffered at her hands as a child, and any pain she subsequently endured appeared to me as a kind of redemption.“ Weil Mutter Tara an Demenz leidet, entschließt sich Tochter Antara, ihre entfremdete Mutter bei sich zu Hause aufzunehmen – und versucht trotz aller vergangenen Auseinandersetzungen, in ihrer Freizeit ein wirksames Mittel gegen Demenz zu finden.
Antara ist Künstlerin, lebt mit ihrem wohlhabenden Ehemann Dilip in der westindischen Metropole Pune. Die Weltanschauung ihres Gatten findet sie meist befremdend, was sie in teils lakonischen, humorvollen Aussagen zur Geltung bringt: „Dilip wants to become a vegetarian because a lion killed a lioness in America yesterday.“
Die beiden sind wohlhabend, verbringen ihre Freizeit in einem Club, den Antaras Großvater einst als eine der wenigen wertvollen Erbringungen der Briten bezeichnete, besuchen Partys, auf denen sie Koks ziehen, „weil jeder andere es auch tut“, und laden ab und zu ein befreundetes Ehepaar auf Cricket-Abende ein, die Antara als reine Zeitverschwendung und Geduldsprobe ansieht – während solcher Abende beschleicht sie „a striking sensation that life is short, that I can feel the minutes ticking by, that I don’t have much time left“.
Das Zusammenleben mit der Mutter verläuft erwartungsgemäß alles andere als unproblematisch, nicht zuletzt, weil die Mutter das Spannungsnetz zwischen Dilip, der immer wieder darüber nachdenkt, nach Amerika auszuwandern, und Antara ausnutzt, um die beiden gegeneinander auszuspielen. Aber auch unabhängig von der dysfunktionalen Beziehung des Ehepaars entpuppt sich Taras Verhalten als schwierig: In der ersten Nacht, die sie im zum Gästezimmer umfunktionierten Atelier verbringt, verbrennt sie die Kunstwerke ihrer Tochter. „Even in her madness, my mother had managed to humiliate me.“
Patchwork-Vergangenheit
Es ist dieses Zusammenleben, das die Erzählstruktur des Romans zwischen Gegenwart und Rückblenden gerechtfertigt: Die Nähe zur Mutter löst einen Erinnerungsschwall aus, der es dem Leser erlaubt, Taras und Antaras schwierige Beziehung nachzuvollziehen. Weil ihre Mutter sich nach ihrer Trauung weigert, einfach hinzunehmen, dass Hochzeiten „meist unglücklich“ verlaufen und sie die „einsame“ und „verzweifelte“ Zeit, in der sie in der Gegenwart der Schwiegermutter „wie ein Hund“ auf die Rückkehr des Ehemanns warten muss, nicht mehr aushält, beginnt sie, ein provokantes und abweichendes Verhalten an den Tag zu legen.
Diese Verweigerungshaltung beginnt mit kleinen Details – sie lässt ihr Haar wachsen, weigert sich, Make-up aufzutragen, raucht heimlich –, nach der Geburt ihrer Tochter verschwindet sie jedoch tagsüber, „dripping with milk, leaving me unfed“, und verlässt kurz darauf Ehemann und Familie, um mit Antara im Ashram zu leben, wo sie dem Sektenführer Baba verfällt und ihre Tochter sowie deren Erziehung vernachlässigt (die Figur des Gurus ist angelehnt an Bhagwan Shree Rajneesh, dessen Lebenslauf vor kurzem nicht nur in einer Netflix-Dokumentation, sondern auch im Sufjan-Stevens-Song „My Rajneesh“ thematisiert wurde).
Antaras früher Lebenslauf ist durch die Verrohung der Beziehung zur Mutter, durch eine bittere Einsamkeit und die Beziehung zur Ersatzmutterfigur Kali Mata geprägt. Tara verlässt den Ashram erst, als der Guru eine neue, jüngere Geliebte an Land zieht. Zu der Zeit ist Antara sieben, kann nicht schreiben und wird in ein Internat gesteckt, wo die Prügel nicht einmal das Schlimmste sind: „Sometimes they were the way we made friends.“ Erst durch die Entdeckung der Kunst wird aus diesem schüchternen Kind, dessen Schularbeiten in jeder geschriebenen Zeile „Unterwerfung“ ausdrücken, eine erwachsene Frau, die ihre Zerbrechlichkeit hinter einer Fassade von Zynismus versteckt.
Künstlerin Antaras Erzählung ist gespickt mit einfachen, schonungslosen Feststellungen, mit denen sie ihr Umfeld – „Dilip is prone to exaggeration“ – und ihre Vergangenheit – „After I married Dilip, I inherited his family, his furniture, and a new set of stray animals“ – lakonisch kennzeichnet. Ihr Tonfall offenbart zeitgleich ein Selbstporträt: Mit jenen trockenen Bemerkungen hält sie sich die Außenwelt vom Leib, im Gegensatz zu ihrer Mutter ist Selbstbeherrschung und emotionale Beherrschung für sie wesentlich: „I began to recognize the chaos inside my mother, to see unlike her I was. Yes, I dripped on occasion, too, but I was always able to seal myself up again.“
Toxische Weiblichkeit
„Burnt Sugar“ ist keine dieser oftmals pathosgetränkten Fiktionen über Demenz, in denen der Leser oder Zuschauer Zeuge des sukzessiven mentalen Zerfalls einer ehemalig heroischen Elternfigur wird: Nicht nur ist das Verhältnis zwischen Erzählerin Antara und ihrer dementen Mutter Tara von Beginn auf toxisch, sodass sich stets eine gewisse Genugtuung in Antaras Pflege und Sorge um die Mutter einschleicht, Antara ist zudem eine zeitweilig unzuverlässige Erzählerin, deren Handlungen durch Taras Fehlleistungen konditioniert sind. So lässt Antara in ihrer Vergangenheitsrekonstruktion einige Etappen bewusst aus und kreidet ihrer Mutter stets Bösartigkeit an.
Die Wunden, die sich beide Frauen zugefügt haben, führen zu einer antagonistischen Wirklichkeitsdarstellung: Laut Antara ist das Vergessen ihrer Mutter „bequem und praktisch“ – „It feels unfair that she can put away the past from her mind while I’m brimming with it all the time.“ Während die Mutter quasi als weibliche Theseus-Figur ihre Glückseligkeit im Vergessen findet, fühlt sich Antara wie Ödipus auf ewig an die traumatische Familiengeschichte gebunden – und muss die Verantwortung dafür nun allein tragen. In diesem kindischen, unreifen Vorwurf entblößt sich die Verletzlichkeit der Erzählerin, aber auch die inhärente Spannung des Romans: Spielt die Mutter ihre Krankheit nur vor, weil ihr das Vergessen zurechtkommt? Oder ist auch diese Vermutung eine Projektion der Tochter, die so ihr eigenes Verhalten legitimiert?
So stellt der Roman nicht nur die Frage, wie man sich aus der toxischen Beziehung zur eigenen Mutter löst, um sich eine unabhängige Identität zu konstruieren, sondern auch, ob man vermeiden kann, diese toxische Beziehung selbst zu reproduzieren: Gen Ende des Romans wird Antara selbst Mutter und verspürt, wie der Vater in Bov Bjergs „Serpentinen“, den Drang, das Leben ihrer Tochter zu beenden, um den Teufelskreis dieser generationsübergreifenden toxischen Weiblichkeit zu beenden (selbst die Großmutter bezeichnet ihre Tochter ständig als „fett“). Erst diese beschämende Erfahrung lässt die Erzählerin feststellen, dass sie ihrer Mutter nicht so unähnlich ist – trotz der wiederholten und vehementen Verneinung dieser Tatsache.
Aufschlussreich für die Deutung des Romans ist nicht zuletzt Antaras Kunstprojekt, an dem sie seit drei Jahren arbeitet und das laut eigener Aussage quasi zufällig begann: „It began by accident, after I drew the face of a man from a picture I found, but the next day, when I went to compare my work to the original, the picture was nowhere to be seen. I searched all day without any luck. By the evening, I had given up. I took another piece of paper (…) and drew the face from my own drawing, copying my own work as faithfully as I could, the careful shading, the exact thickness of line.“
Antara kopiert tagtäglich ihre eigene Zeichnung, das Original ist dabei längst verloren gegangen: Genauso funktioniert auch ihr Erinnerungsvermögen. Wir schreiben die Realität nicht alleine, unsere Wirklichkeitsauffassung ist stets „co-authored“: Ohne das Gegennarrativ der Mutter zerfällt Antaras Welt in einer solipsistischen, fragmentarischen Erinnerungsschleife, in der sich ihre Identität nach und nach auflöst. Dieser Identitätsauflösung steht der Leser bei – „Burnt Sugar“ ist ein zutiefst unangenehmer, jedoch wichtiger Roman.
Info
Avnis Doshi, „Burnt Sugar“, Hamish Hamilton (Penguin Books) 2020, 232 Seiten
Richtigstellung
Die am letzten Freitag erschienene Besprechung von Douglas Stuarts „Shuggie Bain“ stammt nicht aus der Feder von Jeff Schinker, sondern von unserem freien Mitarbeiter Jeff Thoss.
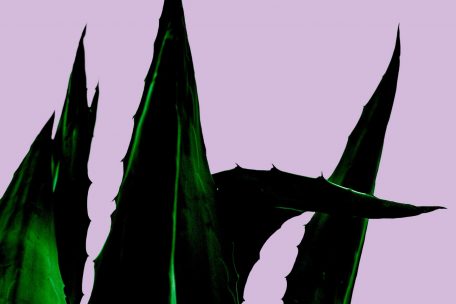










Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können