So praktisch sie auch sind, in der Berufswelt können Handys ein Fluch sein. Immer mehr Menschen sind ständig erreichbar und können sich nicht erholen. An der Universität Luxemburg wurde nun der erste Kollektivvertrag unterzeichnet, in dem das Recht auf Nicht-Erreichbarkeit verankert wurde.
Es gibt Berufe, in denen ist auch nach Verlassen des Büros nicht Schluss. Von immer mehr Beschäftigten wird auch nach der „normalen“ Arbeitszeit erwartet, dass sie erreichbar sind. Im Zeitalter der Digitalisierung nimmt die Zahl derer zu, die auch an Wochenenden, abends oder in der Nacht mit Angelegenheiten ihres Jobs befasst werden. Aber es gibt Hoffnung für die Betroffenen, und das sind laut dem „Quality of work“-Index der Arbeitnehmerkammer mittlerweile rund 50 Prozent aller Beschäftigten, von denen zumindest manchmal erwartet wird, dass sie ihrem Unternehmen auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten zur Verfügung stehen; bei einem Drittel der Angestellten ist dies oft oder permanent der Fall.
Die Arbeitnehmerorganisationen sind sich der Problematik mittlerweile bewusst. In einem ersten Kollektivvertrag wurde nun das Recht auf Nicht-Erreichbarkeit festgeschrieben: Der kürzlich vom OGBL mit der Universität Luxemburg abgeschlossene Tarifvertrag ist der erste, der eine solche Klausel umfasst. Weitere sollen folgen. Solche Regeln machen Sinn: Studien (Sonnentag und Bayer, 2005) haben gezeigt, wie wichtig die psychologische Trennung von der Arbeit in der Erholungs- und Ruhephase des Menschen sind.
Kehrseite der Digitalisierung
Dass immer mehr Menschen von ihrem Arbeitgeber quasi rund um die Uhr in Anspruch genommen werden, ist für die Arbeitnehmerkammer CSL die Kehrseite der Digitalisierung, die eine flexiblere Arbeitsorganisation erlaubt, aber eben auch Grenzen verwischt. So haben flexible Arbeitsformen das Potenzial, neue zeitliche Freiräume zu schaffen, die eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit ermöglichen; allerdings können die Grenzen zwischen Beruf und Freizeit dadurch verwischt werden mit der negativen Auswirkung, dass die auch für die Gesundheit wichtigen Ruhephasen häufig unterbrochen werden, dass also kaum Abstand vom Job möglich ist.
Die Erwartung, die an Arbeitnehmer gestellt wird, erreichbar zu sein, hängt also eng mit der Zunahme der Möglichkeiten zur Heimarbeit zusammen, auch dies ein Phänomen, das mit der Digitalisierung und den damit verbundenen Möglichkeiten, standortunabhängig zu arbeiten, zunimmt. Besonders in sogenannten intellektuellen und wissenschaftlichen Berufen sowie im Management wird laut CSL-Studie in Luxemburg hauptsächlich von zu Hause aus gearbeitet.
Wechselwirkungen mit zunehmender Heimarbeit
Neben den oben erwähnten Berufsgruppen hängt die Häufigkeit der Heimarbeit auch von den organisatorischen Charakteristiken ab: So nutzen Angestellte öffentlicher Verwaltungen sowie europäischer und internationaler Organisationen diese Arbeitsform laut der Studie häufiger als Personal in der Privatwirtschaft. Auch die Größe der Unternehmen hat Einfluss auf die Anzahl der „Heimwerker“: Betriebe mit mehr Personal sind eher bereit, diese Arbeitsform zu akzeptieren. Die Luxemburger nutzen die Möglichkeit am häufigsten, am unbeliebtesten scheint sie bei französischen Beschäftigten einheimischer Firmen zu sein.
21 Prozent aller Beschäftigten arbeiten zumindest ab und zu in ihrer Wohnung für ein Unternehmen. Damit liegt Luxemburg im europäischen Durchschnitt. 13 Prozent hiervon arbeiten jeden Tag von zu Hause aus oder ein oder mehrere Male pro Woche. Frauen sind häufiger in dieser Situation als Männer und junge Menschen weniger oft als ältere. Darüber hinaus arbeiten Personen mit niedrigerem Bildungsstand öfter im Betrieb als jene mit höherem Schulabschluss.
Wie sehen Arbeitnehmer das Phänomen?
Weniger Berufsverkehr und damit verbundene Staus, weniger Energieverbrauch und Umweltbelastung können durchaus positive Folgen der Heimarbeit sein; allerdings werden soziale und berufliche Isolation sowie mangelnder Wissensaustausch neben dem Risiko zur sogenannten Selbstausbeutung als negative Auswirkungen angeführt und eben auch das Risiko, ständig erreichbar sein zu müssen.
Das Bewusstsein, dass es auch mal wichtig ist, nicht ständig von der Firma erreicht werden zu können, ist laut CSL größer bei Frauen als bei Männern. Jene Arbeitnehmer, die sich in der sogenannten „Rush hour“ des Lebens befinden, jene in der Altersgruppe zwischen 35 und 54 Jahren, also wohl auch die, die am häufigsten mit Anrufen oder Mails von ihrem Arbeitgeber konfrontiert sind, messen der Nicht-Erreichbarkeit mehr Bedeutung zu als andere Arbeitsgruppen.
Was die Berufsgruppen betrifft, so zeigen Bürokräfte, Akademiker und Techniker eine positivere Einstellung zum beruflichen Abschalten als etwa Menschen im Dienstleistungssektor oder im Handwerk. Insgesamt wird die Einführung des Rechts auf Nicht-Erreichbarkeit von den Befragten als positiv angesehen. Bei nur 16 Prozent stößt eine solche Maßnahme auf wenig bis gar kein Interesse, die allermeisten sind sich demnach der Problematik bewusst und würden eine entsprechende Reglementierung (wie nun bei der Uni umgesetzt) begrüßen.
„Chefs nutzen auch schon mal Facebook“
Frédéric Krier verhandelte den ersten Kollektivvertrag in Luxemburg, in dem das Recht auf Abschalten vom Job eingeschrieben ist – also jenen der Universität Luxemburg, der erst vor kurzem unterzeichnet wurde. Der Vertrag reiche nicht so weit wie etwa die Abmachungen beim deutschen Autobauer VW: Hier funktionieren die betriebseigenen Mobiltelefone nach Dienstschluss nicht mehr und Server werden abgeschaltet, um zu verhindern, dass Arbeit mit nach Hause genommen und dort erledigt wird.
Im Uni-Tarifvertrag ist festgehalten, dass das Recht auf Nicht-Erreichbarkeit gilt, dass es für die Arbeitnehmer also keine negativen Konsequenzen haben darf, wenn sie außerhalb ihrer Arbeitszeit nicht ans Telefon gehen oder nicht auf E-Mails antworten. In ihrer Freizeit sind sie nicht dazu verpflichtet, die E-Mails überhaupt zu lesen. Das Abkommen gilt auch für jene Geräte, die den Angestellten von der Lehranstalt zur Verfügung gestellt werden.
Ausnahmen gelten für Techniker und anderes Personal, das für seine Erreichbarkeit mit einer Prämie entlohnt wird.
Dem Beispiel der Uni sollen andere Abschlüsse bei anderen Unternehmen folgen – so soll ein entsprechender Artikel im Mantelvertrag für die Forschungsinstitute eingeschrieben werden; auch im Finanzbereich will der OGBL ähnliche Regelungen finden.
Bei den Verantwortlichen der Universität stieß die Einführung der Nicht-Erreichbarkeits-Klausel kaum auf Widerstand; es gibt aber wohl auch Arbeitgeber, die so eine Regel als überflüssig ansehen. Dabei soll es vereinzelte Chefs geben, die ihre Anweisungen auch schon mal über Facebook geben, wenn das Telefon aus ist.

 De Maart
De Maart





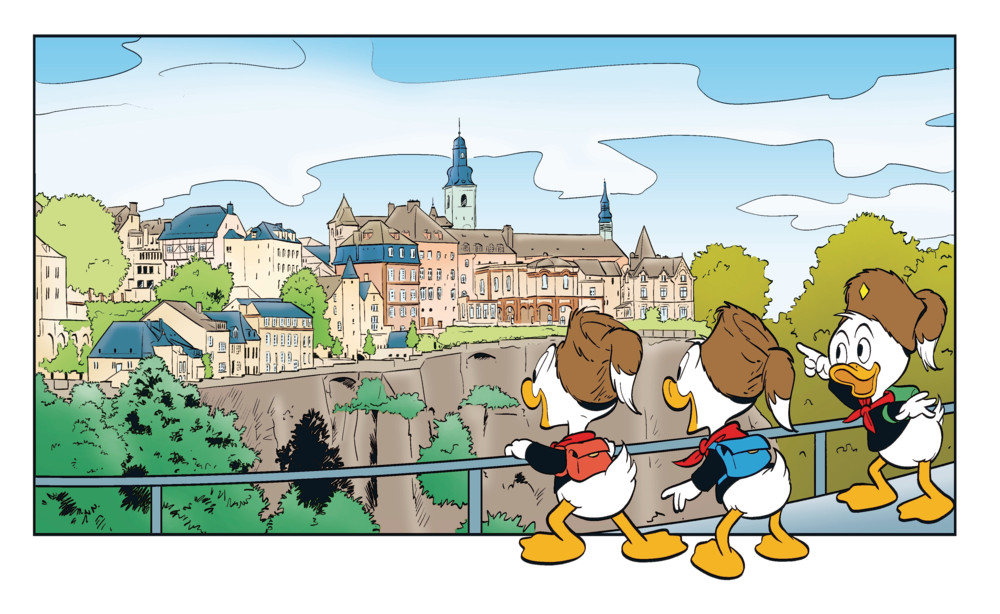


Herr Schneider,
Recht auf Abschalten...................
Déi.déi all Minut op hiren Handy sturken, maachen daat net onbedingt wéint der Aarbecht.