„Manchmal, oft hatte ich mir gesagt, dass es kein Anzeichen von seelischer Gesundheit war, sich an eine zutiefst gestörte Familie anpassen zu können.“ Ein Vierteljahrhundert nach seinem Debüt „Faserland“ verschlägt es Erzähler Christian Kracht – nicht zu verwechseln mit Schriftsteller Christian Kracht – für ein paar Tage nach Zürich, wo er regelmäßig nach seiner alkoholkranken, tablettenabhängigen, verrückten Mutter schaut.
Während er sich darauf vorbereitet, die alte Dame zu besuchen – als Schweizer Autor kommt man nie ganz ohne Dürrenmatt-Bezug aus –, sinniert er über die durch und durch dunkle, dekadente Geschichte seiner Familie. Dabei denkt er immer wieder an die Mutter, die im Alter von elf Jahren von einem Fahrradhändler vergewaltigt wurde und nicht aussagen durfte, weil der Händler ein Cousin des damals amtierenden NSDAP-Bürgermeisters Kurt Petersen war.
Er denkt an den Vater, der die rechte Hand von Axel Springer, aber auch ein Hochstapler, der gefälschte Fotos einer „fake graduation“ an einer US-amerikanischen Uni nach Hause schickte, und ein „Machtmensch“ war, der auf Erniedrigung anderer setzte, weil er als Neureicher stets nur auf ebendiese Erniedrigung stieß. An den Großvater mütterlicherseits, der sich nach einer „vollkommen erfolglos verlaufenen Entnazifizierung“ sofort daranmachte, „das Netzwerk der alten Kameraden der SS zu reaktivieren“, der als Au-pair-Mädchen ausschließlich Isländerinnen, „in deren Blutströmen auf ewig die heilige Edda sang“, engagierte und nach dessen Tod man eine Sammlung sadomasochistischer Utensilien in einer Geheimkammer fand.
All dies steht natürlich als pars pro toto für die Zustände im Nachkriegsdeutschland, in dem „die Verquickung der Ehemaligen der SS mit sämtlichen Gebieten der bundesrepublikanischen Gesellschaft“ schnell zur Selbstverständlichkeit wurde.
Dem Erzähler bleibt dabei der „größere Zusammenhang der Umstände seiner Familie“ abhanden – vielleicht, weil niemand im Nachkriegsdeutschland über irgendwas redete, vielleicht, weil die Familiengeschichte zumindest teilweise ein Lügengestrick ist, vielleicht aber auch, weil es zwischen „den deutschen Expressionisten meines Vaters auf der einen Seite, also den entarteten Künstlern, und auf der anderen, auf der mütterlichen Seite, von den Künstlern der SS, die Bilder malten, die sie ‚Es reitet der Tod’ nannten“, keinen gemeinsamen Nenner, keinen Zusammenhang geben kann.
Letzter Roadtrip
Weil er sich vom Treffen mit der psychisch kranken Mutter seit langem keine verspätete Epiphanie, keine der erwünschten Zusammenhänge erwarten kann, entscheidet sich Christian, mit ebendieser durchgeknallten Mutter, deren „Palimpsest“ eines Gesichts, „vom betrunkenen Hinfallen zerschrammt und mit dunkelroten Blutkrusten überzogen“, die „Talfahrt dieser Familie“ verdichtet, zum womöglich letzten Roadtrip aufzubrechen.
Nachdem die Mutter 600.000 Franken bei einem schmierigen Banker abgehoben hat, beschließen beide, das schmutzige Geld, das die Mutter durch Investition in Waffenaktien erwirtschaftet hat, an Leute zu verschenken, die damit etwas Sinnvolles schaffen könnten.
Fortan klappern Mutter und Sohn die wirren Stationen eines neoliberalen Kreuzweges durch die zeitgenössische Schweiz ab: Während die Mutter ständig Wodka und billigen Weißwein trinkt, Tabletten schluckt und sich beschwert, ihr Sohn wäre nie für sie dagewesen, führt der Erzähler sie in eine vegetarische Hippie-Gemeinschaft, die sich als Nazikommune entpuppt, zum Forellenessen und Edelweißsuchen auf das Col du Pillon und schließlich ans Grab von Borges.
„Irgendwie drehen wir uns im Kreis“, meint die Erzählfigur, als die Mutter ihn zum wiederholten Male fragt, ihr doch die Wodkaflasche zu reichen. Dem Leser dürfte es während der Lektüre von „Eurotrash“ streckenweise nicht unähnlich ergehen, denn Krachts Hang zum postmodernen Vexierspiel zwischen Wahrheit und Fiktion, Geld und Müll, „Brot und Speichel“ erschöpft sich irgendwann selbst.
Nach einigen starken ersten Kapiteln, während denen die ganze Hässlichkeit einer deutschen Familiengeschichte in einem Stil zwischen dandyhafter Eleganz und punkiger Wut fragmentarisch nacherzählt wird, wird der Roadtrip mit der Mutter irgendwann redundant, spannungsarm und etwas ziellos. Dieser zweite Teil des Buches versteht sich teilweise als märchenhaft-allegorisch, bleibt aber oft im nüchternen Zynismus der Erzählfigur stecken: Kracht will gleichzeitig die Talfahrt in die Vergangenheit und den Höhenflug in die Fiktion, oft fällt ihm aber nicht mehr ein, als fiktionale Figuren sagen zu lassen, dass sie im Gegensatz zu Quichotte echt sind.
Postmodernismus nach Zahlen?
Das Spiel mit der Allwissenheit des Erzählers; die Figur, die mit einem anderen bekannten Autor verwechselt wird – seit Paul Austers „New York Trilogy“ ein Klassiker der Postmoderne –; die Kluft, Trugschlüsse und Identitätsspiele zwischen Autor und Erzähler, die dadurch entstehen, dass Kracht so einige autobiografische Elemente in seinen Roman importiert, diese jedoch verzerrt, entstellt oder in andere Zusammenhänge bringt; die eingebetteten Mikroerzählungen, der postmoderne Diskurs über die Verwischung von Wahrheit und Fiktion: all das hat man trotz Krachts Stilsicherheit bereits noch und nöcher gelesen.
Irgendwann weicht die Abrechnung mit der Familienvergangenheit einer erstaunlich leeren Identitätssuche: Viel hat die Erzählfigur Kracht nicht über sich selbst zu sagen, weswegen er sich irgendwann auf die Mutterfigur fokussiert, deren Zeichnung streckenweise äußerst empathisch und berührend ausfällt, anderswo aber zu karikaturhaft wirkt, sodass einige der Mutter-Sohn-Dialoge gestelzt klingen und einige Szenen wie aus einem Creative Workshop wirken (gegen Ende des Roadtrips denkt man immer wieder an (eine entpolitisierte Version von) „Goodbye Lenin“).
Wie in Andreas Maiers „Die Familie“ geht es in „Eurotrash“ um die Schweigekinder und um die Kinder der Schweigekinder, um die Verdrängung der nationalsozialistischen Familienvergangenheit – nur fehlt Kracht in „Eurotrash“ die Subtilität, mit der Maier progressiv den Grad der Verhüllung preisgab. Und wie in Bov Bjergs „Serpentinen“ (das letztes Jahr auch auf der Buchpreis-Shortlist gelandet war) geht es um eine kaputte Beziehung zwischen einem Elternteil und einem Sohn, die die kaputte Beziehung Deutschlands zur eigenen Vergangenheit verdichten soll. Kracht ist jedoch besser darin, dem Ekel des Erzählers in den stilistisch pointierten ersten Kapiteln Ausdruck zu verleihen, als den Versuch einer Wiedergutmachungsreise mit der Mutter empathisch zu erzählen. Dies mag sehr wohl gewollt sein – der Roman endet trotz einer Gondelfahrt in die Berge dann doch eher in einem Tal der Klischees.
Am vergangenen Montag ging Christian Krachts „Eurotrash“ bei der Buchpreis-Verleihung leer aus: Der Deutsche Buchpreis 2021 ging an „Blaue Frau“ von Antje Rávik Strubel. Der Roman wird in absehbarer Zeit hier im Tageblatt besprochen.
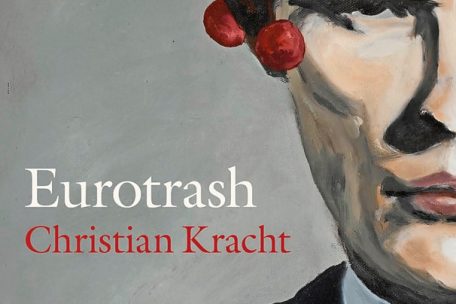
Info
„Eurotrash“ von Christian Kracht, KiWi 2021, 224 S.










Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können