Rückzug in die Provinz und in die Vergangenheit mit „The Bookshop“ und „Damsel“, Liebe und Generationskonflikt in „Eva“ und „The Heiresses“: Die ersten Beiträge sind qualitativ relativ unausgewogen und pendeln oftmals im Mittelfeld. Nichtsdestotrotz bleibt die Berlinale ein interessantes Stimmungsbarometer der weltweiten Filmszene – wer
hier nicht glücklich werden sollte, halte das offizielle Erscheinungsdatum von „Isle of Dogs“ weiterhin im Auge.
 (Buch)wurm drin?
(Buch)wurm drin?
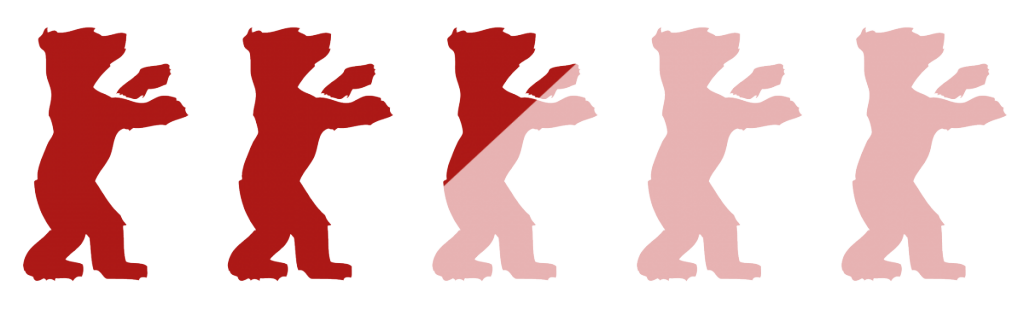
The Bookshop erzählt die Geschichte von Florence Green (Emily Mortimer), einer Frau, die sich einen lebenslangen Traum erfüllen möchte, indem sie in einem gottverlassenen englischen Dorf einen Bücherladen eröffnet.
Wer jetzt fürchtet, der Film würde sich hauptsächlich an Leute richten, die auf Facebook dekorative Fotos von Büchern posten, die neben einer Tasse Kaffee oder einer Teekanne liegen, um ihrer Liebe zum Schriftgut so Ausdruck zu verleihen (weil für diese Aufmerksamkeitsbedürftigen das Konzept Buch wichtiger ist als ihr Inhalt), liegt nur teilweise richtig. Anfangs scheint dem Film aber eine solche vereinfachte Herangehensweise zum gedruckten Objekt zugrunde zu liegen: So erfährt man, dass der berühmt-berüchtigte Dorfmisanthrop und Einsiedler Mr. Brundish (Bill Nighy) die Umschläge der Bücher verbrennt, falls dort Fotos der Autoren kursieren – Mr. Brundish kann die Idee nicht ausstehen, dass sich reale Menschen hinter diesen Werken verstecken. Eine solch bemühte Figurenzeichnung wirkt leider schwachsinnig: Jeder, der sich wirklich für Literatur interessiert, findet gerade die Tatsache, dass sich hinter literarischen Überwerken fehlbare Menschen befinden, bemerkenswert.
Die Story wird nach anfänglichen Fauxpas und Binsenwahrheiten über die Glückseligkeit der Bücherlesenden aber glücklicherweise durch exzentrische Nebenfiguren kompliziert: Die garstige Violet Gamart (Patricia Clarkson) will das alte Haus, in dem Florence ihren Bücherladen eröffnen will, unbedingt in ein Kunstzentrum umwandeln (wieso, weiß niemand so recht und scheint leider auch den Drehbuchautor nicht sonderlich interessiert zu haben) und hat dafür ihren schmierigen, undurchsichtigen Sidekick Milo North (überzeugend: James Lance) zur Seite. Beide werden alles tun, um Florence’ Betrieb in den Ruin zu treiben, während Letztere den alternden M. Brundish via Ray Bradbury und Wladimir Nabokows „Lolita“ ans Tageslicht lockt. Stichwort Brundish: Andere projizierte Filme führen das Thema einer romantisch angehauchten Beziehung mit reiferen Damen und Herren fort (siehe „The Heiresses“ und „Eva“).
Der Film erzählt letztlich (und das rettet ihn) die Geschichte einer sturen, geduldigen Frau, die eigensinnig ihren Willen durchsetzen möchte und die Augen vor der Boshaftigkeit ihrer Mitmenschen bewusst verschließt, um deren Gemeinheit, die sie zwar erkennt, dann aber ausblendet, keinen Platz in ihrem Weltbild zu lassen. Dass dies zum Scheitern verurteilt sein muss, tut weder ihrem Charme noch dem Porträt, das der Film geduldig zeichnet, einen Abbruch. Nichtsdestotrotz: Wer Fiktionen, die in Bücherläden stattfinden, mag, sollte sich lieber die Serie „Black Books“ anschauen.

Taxi Driver
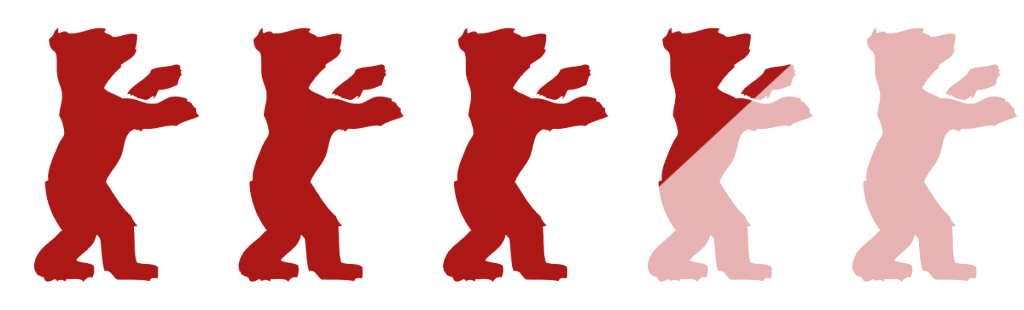
The Heiresses erzählt die Geschichte eines homosexuellen, alternden Pärchens, das von einem schweren Schicksalsschlag getroffen wird: Chiquita hat ein Darlehen nicht zurückerstatten können und muss nun deswegen im Gefängnis eine Strafe absitzen. Parallel dazu werden im Haushalt kostbare, wenn auch nicht unbedingt notwendige Möbel verkauft, was die relativ stumme Partnerin Chela zur Weißglut zu treiben scheint – es sind vor allem ihre Besitztümer, die nach und nach den Haushalt verlassen.
Als Chiquita dann im Knast sitzt, wird Chela von ihrer alternden Nachbarin – einer mit Ketten behangenen Spießbürgerin – als Taxifahrerin rekrutiert. Da sie von der Nachbarin jedes Mal – aus Mitleid und/oder weil Chela billiger als ein Taxi ist – Geld zugesteckt bekommt und die Nachbarin die Dienste schnell outsourcet, findet die schweigende Chela plötzlich Gefallen am Unterfangen – auch wenn sie keinen Führerschein besitzt.
Als sie dann auch noch zur regelmäßigen Chauffeurin der selbstsicheren femme à hommes Angy, des Dienstmädchens der Nachbarin, wird, erfährt Cela einen späten Gefühlsfrühling – obwohl seitens der heterosexuellen, jungen Angy nur dann ermutigende Signale gesendet werden, wenn sie Chela gerade für eine Fahrt braucht.
„The Heiresses“ porträtiert subtil den ungerechten, unaufhaltsamen Altersprozess eines Körpers, der immer noch von biologischer Lust getrieben wird. Wie in „The Bookshop“ geht es hier um Gefühle (egal ob Liebe, Lust oder Leidenschaft) für eine viel jüngere Person, nur ist diese Beziehung, die im Keim erstickt wird, viel nuancenreicher dargestellt – was teilweise auch an dem wirklich ausgezeichneten Schauspiel von Ana Brun liegt.
Wie Proust bereits sagte: Liebe ist immer unausgeglichen. Jean Racines Liebeskette der Andromache wird hier prächtig illustriert: Chiquita liebt Chela, die allerdings Angy liebt. Bei „The Heiresses“ kommt das Tragische ganz ohne Pathos aus – und bekommt eine ordentliche Dosis Narzissmus auferlegt: Die Kette der Liebschaften endet nämlich mit Angy, die viele Männer, aber vor allem die Bestätigung der eigenen Schönheit begehrt.
Schön auch, dass der Film das Verhalten der introvertierten Chela nicht schematisiert, nicht urteilt, nicht psychoanalysiert: Die Kamera begleitet stumm, folgt Chela auf Schritt und Tritt, verrät wenig Emotionen. Die Regie dramatisiert nichts, überlässt dem Zuschauern das Urteil, ermutigt aber zu einer empathischen Toleranz für die tagtäglichen (Irr)fahrten seiner Hauptfigur.

Ein Don Quichotte im feministischen Wilden Westen

Damsel mit Robert Pattinson und Mia Wasikowska lässt einen etwas ratlos zurück (die Journalisten auf der Berlinale reagierten mit Buhrufen und Applaus, einige verließen den Saal, andere lachten, meine Nachbarin schüttelte nur den Kopf), dem Film liegen allerdings einige interessante Grundzüge zugrunde, die es legitimieren, dass man sich ihn anschaut. Und sei es nur, um darüber zu entscheiden, ob man ihn jetzt hasst oder nicht.
Zu Beginn stellt der Film ein ungleiches Paar vor: Henry (Ko-Regisseur David Zellner) ist ein versoffener Pfarrer, der eine kaputte Bibel herumträgt und scheinbar wenig von seinem Metier versteht, Samuel (Robert Pattinson) gibt den gitarrenspielenden Jungspund, den man zu Beginn des Films neben seiner Angebeteten Penelope (Mia Wasikowska) dämlich grinsen und zappelnd tanzen sieht. Beide machen sich auf, um Samuels Begehrte, die, wie der Möchtegern-Cowboy es relativ spät zugibt, entführt wurde, zu suchen. Die beiden ziehen auf ihren Pferden durch die Prärie, Pattinson spielt lächerliche Songs und man weiß eine Zeit lang nicht recht, ob man jetzt mit dem Film über die Ungeschicklichkeit seiner Figur oder gegen den Film über dessen Ungeschicklichkeit lachen soll.
Schnell aber zeigt sich, dass Samuel ein Schwindler ist, der seine Rolle des Befreiers mit großer Ernsthaftigkeit spielt, diese versteckt aber nur kurz, dass Samuel ein Cowboy-Pendant von Don Quichotte ist – ein selbstsicherer Schwindler, der sich selbst belügt und betrügt. Als man dann vor der Hütte des vermeintlichen Entführers steht, springt einem die Wahrheit ins Auge – und der Film nimmt fortan eine wagemutige Wendung, die zeigt, dass seine Penelope nichts von einer Prinzessin hat.
Klar werden hier Genre-Klischees im doppelten Sinne der französischen Bedeutung des Wortes (das Kinogenre des Westerns und die Darstellung der Geschlechterrollen innerhalb dieser Filme) auf den Kopf gestellt. Klar hat der Film seine grotesken Momente, die von einem sicheren Gespür für (geschmacklosen) Humor zeugen – den ich eigentlich sehr mag. Nichtsdestotrotz ist der Film unausgewogen, wirkt zu unstrukturiert, zu willkürlich, zu orientierungslos, ein bisschen so, als hätte man das Drehbuch während der Dreharbeiten nach und nach fertiggestellt. Zu grobschlächtig wird seine gut gemeinte feministische Persönlichkeit an den Tag gelegt. Interessant bleibt die Radikalität und die fast improvisierte Natur des Plots dennoch.

Fraudeur en série
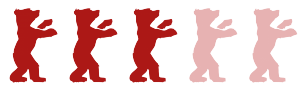
Eva commence par une fraude: Bertrand Vallade (Gaspard Ulliel) profite de la mort accidentelle d’un de ses patients – un vieil écrivain anglais salace qui venait d’inviter le jeune homme à le rejoindre dans le bain que celui-ci lui a fait couler – pour s’approprier le tout dernier manuscrit du décédé. Après ce prologue diaboliquement prometteur, on en arrive illico, à coup d’ellipse et de niveaux méta, à une séquence où Bertrand est couronné nouvelle star de la scène théâtrale parisienne, ce dont on peut s’apercevoir immédiatement de par le fait qu’une blonde sublime, Caroline (Julia Roy) lui saute au cou.
Evidemment, Bertrand ne sait pas écrire. Evidemment, il a un éditeur qui le harcèle pour qu’il ponde son prochain chef-d’œuvre. Evidemment, ça ne peut que mal se terminer (on pense à „You Will Meet a Tall Dark Stranger“ de Woody Allen, pour l’histoire de manuscrit volé). Bertrand finit par se réfugier dans le chalet familial de sa copine, où il tombe sur une femme confortablement calée dans la baignoire (Isabelle Huppert) et un homme qui lui suggère de la partager. Elle, c’est l’Eva du titre, une femme mûre qui vend son corps à qui le veut bien (et qui dispose d’assez de sous pour ce faire, car Eva est chère).
Bertrand, tombé quelque peu sous le charme, la revoit par hasard à Annecy et cherche à tisser une relation avec Eva pour pouvoir ensuite retranscrire plus ou moins fidèlement cette rencontre dans sa prochaine pièce – on connaît la rengaine du beurre et de l’argent du beurre et de la crémière. Et on a envie de lui dire, à Bertrand, que c’est rarement comme ça que ça marche, l’écriture.
Si le film, scénaristiquement, tire un peu trop dans tous les sens – aventure érotico-gérontophile, histoire d’adultère, portrait d’un sale type, parodie de la scène artistique parisienne, avec toutefois certains personnages sans beaucoup de relief (Régis), portrait de la création artistique et de son imbrication dans le réel –, il n’en reste pas moins que cette histoire vaut avant tout pour sa réflexion sur l’écriture – Bertrand accumule du vécu dans l’espoir de vivre une histoire qui vaille la peine d’être racontée, mais n’arrive qu’à bousiller sa propre vie, car les deux niveaux (vécu fictionnel et vécu réel) ne sont jamais tout à fait étanches.
S’y ajoutent un très bon jeu d’acteurs, un portrait somme toute assez mystérieux d’une femme qui vend son corps sans, paraît-il, la moindre gêne et une mise en scène à double fond, tout en poupées russes, autour d’une duperie émotionnelle dans laquelle on ne sait plus qui est en train de piéger qui.










Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können