Zeitgenössische französische Literatur exportiert sich heutzutage eher schlecht. Dem jungen französischen Schriftsteller Edouard Louis ist es allerdings gelungen, nach nur zwei veröffentlichten Romanen bereits in 27 Sprachen übersetzt zu werden. Seine beiden Bücher praktizieren eine Literatur, die sich nicht von der Realität abwendet, sondern sie im Gegenteil konfrontiert, um sich einer soziologischen und autobiografischen Wahrheit anzunähern. Wir haben den jungen Autor, der am Dienstag vom Institut Pierre Werner in Neimënster eingeladen worden war, auf ein exklusives Gespräch getroffen.
Von Jeff Schinker
Die beiden ersten Romane von Edouard Louis hinterlassen beim Leser ein umso mulmigeres Gefühl, da die beschriebenen Ereignisse wahrheitsgetreuen autobiografischen Ereignissen entsprechen. Im Laufe des ersten Romans „Das Ende von Eddy“ erzählt Louis seine Kindheit in einem gottverlassenen französischen Dorf. Von seiner Kindheit sagt Louis, er könne ihr keine einzige glückliche Erinnerung anhaften, da er sie als doppelt Ausgegrenzter verbrachte.
Eddy ist Teil einer Arbeiterfamilie, die sich an der Armutsgrenze befindet, eine Arbeiterfamilie, die von Alkoholismus und grobschlächtigem Rassismus, sozialer Ausgrenzung und einer fast schon zyklischen Gewalt geplagt ist. Unter diesen Ausgegrenzten fühlt sich Eddy aber nochmals verworfen, da er schnell merkt, dass er anders ist, man sich über sein feminines Auftreten lustig macht und er mit den vier semantischen Eckpfeilern der männlichen Dorfbevölkerung – Mädels, Bier, Fußball, Schlägereien – herzlich wenig anfangen kann.
Tageblatt: Deine Bücher beanspruchen eine autobiografische Wahrheit. Bleibt da noch Platz für Fiktion?
Edouard Louis: Fiktion interessiert mich eigentlich nicht. Das Milieu, aus dem ich stamme, hat mir den Luxus der Fiktion geraubt. Ich bin so sehr Einflüssen von chauvinistischem Patriarchat – meine Mutter durfte nicht arbeiten gehen, weil sie eine Frau ist –, Rassismus – das Dorf, aus dem ich stamme, hat zu 60% den Front national gewählt – und Armut ausgesetzt gewesen, dass ich es mir nicht leisten konnte, nicht über diese Realität zu schreiben. Klar, ich hätte daraus eine Fiktion spinnen können, aber ich glaube, es gibt in der Literatur eine politische Kraft der Wahrheit. Wenn das Geschilderte wahr ist, wieso soll ich dann lügen, indem ich behaupte, es wäre fiktional? Im sozialen Betätigungsfeld der Literatur wird man quasi zur Lüge gezwungen. Ich glaube aber, dass es heutzutage fast eine Art Gegenbewegung gibt, die sich mit dem Konzept der Wahrheit in der Literatur auseinandersetzt: Autoren wie Ta-Nehisi Coates, Karl Ove Knausgaard oder Svetlana Alexievich beschäftigen sich mit der Wahrheit und haben deswegen das Potenzial, politisch zu destabilisieren.
Kann Fiktion denn nicht auch ein Werkzeug sein, um das Wahre zu erreichen?
Es gibt in der Literatur eine Art Ideologie, die sich dem Begriff der Wahrheit entgegenstellt. Ich versuche hingegen, Bücher zu schreiben, denen eine Art Ethik der Wahrheit innewohnt. Wenn man über Gewalt spricht, gerät man schnell in den Verdacht, zu übertreiben. Frauen, die von sexueller Gewalt berichten, wird dies ständig vorgeworfen. Mir wurde dies auch vorgeworfen. Wenn dann jemand mich verteidigte, hieß es sofort, es wäre doch ganz gleich, ob ich übertrieben hätte oder nicht. Wir befänden uns doch im Bereich der Literatur, da spiele dies keine Rolle. Ich fühlte mich zwischen diesen beiden Positionen eingesperrt. Wenn ich über meine Schwester, die von ihrem Freund verprügelt wurde, schreibe, ist es nicht gleichgültig, ob dies jetzt wahr oder erfunden ist. Eine Literatur, die nicht über die Welt redet, in der wir leben, brauche ich nicht. Es gibt Wahrheiten, über die man streiten kann – und es gibt objektive Wahrheiten. Armut, Vergewaltigung, das körperliche Leiden eines Fabrikarbeiters: Das sind unanfechtbare Gegebenheiten. Manchmal denke ich, Literatur wurde dazu benutzt, um sich von der Wirklichkeit abzukehren, ein bisschen so, als wenn man beschämt wegguckt, wenn man einem Obdachlosen auf der Straße begegnet.
Redest du deswegen so oft vom kollektiven Lügen, von der Art und Weise, wie die Leute und die Gesellschaft sich selbst anlügen?
Genau. Die Leute neigen dazu, sich eine alternative Wirklichkeit zu gestalten, um unangenehmen Wahrheiten aus dem Weg zu gehen. Die Literatur hat bei diesen Prozessen oft mitgewirkt. Für mich ist es an der Zeit, dies zu beenden. Die engagierte Literatur eines Zola ist nicht mehr ausreichend. Es gibt heute so viele Mechanismen, die dazu dienen, die Realität zu leugnen, dass es nicht mehr genügt, die Wirklichkeit bloß zu sagen, sie zu umschreiben. Deswegen versuche ich, eine Literatur der Gegenüberstellung zu schaffen, die den Leser dazu zwingt, der Wirklichkeit und dem, was ich schreibe, in die Augen zu schauen. Aus diesem Grund gibt es in meinen Büchern Momente von soziologischer Analyse, und ebendieser Grund legitimiert den autobiografischen Prozess, der in meinem Werk immerzu unterstrichen wird. Deswegen praktiziere ich auch eine Literatur, die Metaphern verwirft. Da, wo Jean Genet schreibt, die Spucke, mit der die anderen Sträflinge ihn (und seine Homosexualität) im Knast demütigen wollten, wäre mit Rosen vergleichbar gewesen, möchte ich ausdrücken, dass die Spucke, die mir galt, einfach Spucke war. Es geht darum, auf Metaphern zu verzichten, ohne die Literatur aufzugeben.
Dieser autobiografische Prozess des persönlichen Entblößens scheint in deinem zweiten Roman noch verstärkt zu sein. Du benutzt etwa häufiger reale Vornamen.
Für „Im Herzen der Gewalt“ erschienen mir die Vornamen wichtiger, da es auch ein Roman über Freundschaft ist, ein Roman über die Art und Weise, wie meine Freunde – Didier Eribon und Geoffroy de Lagasnerie, denen ich meine beiden Romane auch gewidmet habe – mir geholfen haben, über die Gewalt, der ich zum Opfer fiel, hinwegzukommen. Es sind meine Freunde, die mir dabei halfen, meinen neuen Namen – Edouard Louis – auszuwählen. Dieser ist übrigens nicht bloß ein Pseudonym; ich wollte, dass der Name auch auf meinem Ausweis steht. Mit Didier und Geoffroy saßen wir in einem Café und haben zusammen über meinen Namen diskutiert und ihn dann ausgewählt. Man könnte fast sagen, ich bin durch und mit meinen Freunden geboren.
Dein erster Roman erinnert nicht nur an „Rückkehr nach Reims“ von deinem Freund Didier Eribon, sondern auch an Bücher wie „Die Beschissenheit der Dinge“ von Dimitri Verhulst oder „Tom auf dem Lande“ von Michel Marc Bouchard.
All diese Werke porträtieren ein und dieselbe Welt. Ich wollte über die Armut reden, aber auch über die Demütigung, die die Leute aus diesem Milieu im Alltag erleben. Vor kurzem sagte Macron, dass man in einem Bahnhof all möglichen Leuten begegnet und unterschied zwischen den Leuten, die erfolgreich durchs Leben gehen und denjenigen, aus denen nichts wurde. Seitdem Macron an der Macht ist, wird die Unterschicht, das Lumpenproletariat ständig erniedrigt – und damit wird diese Erniedrigung auch noch gesellschaftlich legitim. Wenn man einer solchen Gewalt ausgesetzt wird, ist es mehr als wahrscheinlich, dass man diese Gewalt dann auch im Alltag wiederholt. Dies findet man in „Tom auf dem Lande“ wieder. Um es etwas grob auszudrücken, gibt es, was die Unterschicht anbelangt, zwei Ideologien: Die Macron-Ideologie, laut der die Armen einfach Faulenzer sind, und die linke Ideologie, die das einfache Volk idealisiert. In diesem Mythos der Linken gibt es aber kein Platz für die LGBT-Gemeinde, man beschränkt sich auf ein heteronormatives Bild dieser Schicht. Als ich zu schreiben begann, fühlte ich mich von diesen zwei Gesellschaftsbildern in die Enge getrieben. Ich musste also einen dritten Diskurs finden: Es erschien mir wichtig, über den Kreis der Gewalt zu schreiben. Man übt Gewalt aus, weil man gesellschaftliche Gewalt erlitten hat. Wenn mein Vater betrunken war, weinte er ständig – er präzisierte allerdings immer, dass Männer nicht weinen dürfen – und fragte sich, wieso er so gewalttätig sei. Die Gewalt, die ihn durchquerte, war die Gewalt der Klassengesellschaft, der sozialen Erniedrigung.
In deinen Büchern sieht man die Theorien von Bourdieu in der Praxis: Es gibt Klassengewalt, aber auch das sprachliche Defizit der Unterschicht, das du immer dann nachahmst, wenn du jemanden aus deiner Familie reden lässt. Wenn deine Erzählfigur spricht, tut sie dies allerdings in der sauberen Aussprache des Pariser Intellektuellen, zu dem du geworden bist. Stellst du dich nicht, in diesem sprachlichen Kräfteverhältnis, auf die Seite der dominierenden Klasse?
Didier Eribon sagt immer: Wenn wir über die Arbeiterklasse reden können, dann ist dies nur möglich, weil wir ihr nicht mehr angehören. Wenn meine Mutter ein Manuskript an mein Verlagshaus schicken würde, würde man es nicht veröffentlichen. Ich wollte in meinen Romanen der Sprache meiner Kindheit einen literarischen Platz geben, wollte zeigen, dass auch diese Sprache die Wirklichkeit spiegeln kann. Ich wollte außerdem klarstellen, wie gewalttätig diese Sprache sein kann, dass Rassismus und männliche Vorherrschaft ein Teil von ihr sind. Es ging mir darum, sowohl zu zeigen, wie die „korrekte Sprache“ die Ausdrucksformen der Unterschicht dominiert, als auch die inhärente Gewalt meiner Kindheitssprache anzuprangern. Mein Vater musste sich nicht mal bewusst gewalttätig zeigen: Indem er sich unserer Sprache bediente, war er es bereits. Er bezeichnete mich als „Schwuchtel“, weil er keinen anderen Ausdruck kannte, um meine Sexualität zu bezeichnen. In diesem Kontext gibt es eine sehr interessante Geschichte, die Primo Levi in „Die Untergegangenen und die Geretteten“ erzählt. Levi lernte Deutsch in Auschwitz. Als er dann Jahre später ein Arbeitstreffen mit deutschen Chemikern hatte, wollte er ihnen zeigen, dass er Deutsch kann und wollte sich dann auf Deutsch von ihnen verabschieden. Er sagte allerdings so etwas wie: „Verpisst euch, ihr Einfaltspinsel“ – weil die Sprachform, die er im Konzentrationslager gelernt hatte, bereits von Gewalt durchdrungen war.
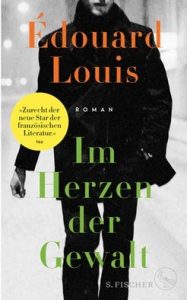 In seinem zweiten Roman, „Im Herzen der Gewalt“, erzählt Edouard Louis, wie er Jahre später als schwuler Pariser Intellektueller an einem 25. Dezember Reda kennenlernt und ihn auf ein Getränk in seine Wohnung einlädt. Die Geschichte endet mit versuchtem Totschlag und einer Vergewaltigung.
In seinem zweiten Roman, „Im Herzen der Gewalt“, erzählt Edouard Louis, wie er Jahre später als schwuler Pariser Intellektueller an einem 25. Dezember Reda kennenlernt und ihn auf ein Getränk in seine Wohnung einlädt. Die Geschichte endet mit versuchtem Totschlag und einer Vergewaltigung.
Hier gibt es eine Leseprobe.
Bei „Im Herzen der Gewalt“ ist die Erzählstruktur viel komplexer als in deinem Debütroman: Deine Schwester erzählt ihrem Ehemann deine Geschichte, du hörst stumm zu, kommentierst, machst Richtigstellungen, flechtest Kommentare der Polizisten, der Ärzte mit ein. Wie hast du die Form für dieses Buch gefunden? Waren die verschiedenen Erzählschichten notwendig, um ein so unsägliches Thema zu behandeln?
Erstmals wollte ich für dieses Buch nicht dieselbe Erzählform verwenden als bei „Das Ende von Eddy“. Ich wollte nicht das gleiche Buch nochmal schreiben, das erschien mir langweilig. Gleichzeitig hat diese Wahl natürlich auch mit dem Thema des Buches zu tun. Sobald ich meine Zeugenaussage machte, sobald ich anfing, diese Geschichte zu erzählen, fingen andere Leute an, sie sich anzueignen. Wenn du gegen jemanden Anzeige erstattest, gibt es eine ganze Reihe an Institutionen, an Autoritäten – Polizisten, Richter, Ärzte –, die anfangen, deine Geschichte an deiner Stelle zu erzählen. Und du erkennst dich nicht notgedrungen in diesen Erzählungen wieder. Reda hatte zum Beispiel einen algerischen Vater. Als ich der Polizei dies berichtete, erkannte ich sofort, wie die beiden Polizisten mein Erlebnis ausnutzten, um die Geschichte eines Algeriers, der einen zentraleuropäischen Weißen angreift, zu konstruieren. Meine Geschichte wurde entstellt, sie wurde zweckentfremdet, um ein rassistisches Märchen zu erzählen. Die erzählerische Montage soll aufzeigen, wie Andere immer wieder Besitz von unseren Erlebnissen ergreifen. Es gibt eine intrinsische Gewalt in diesem Prozess. Bevor ich Anzeige erstattete, sagte ich: „Ich bin Opfer einer Vergewaltigung.“ Danach sagte man: „Du bist das Opfer.“ Diese grammatikalische Umkehrung hat mich meiner Geschichte entraubt.
Als du Anzeige erstattest, schreibst du, man hätte dich von deinem Erlebnis ausgegrenzt, da ein Polizeibeamter dir erklärte: Ab jetzt kannst du den juristischen Prozess nicht mehr bremsen. Das Schicksal von Reda liegt in den Händen der Polizei, der Justiz.
In der Welt, in der wir leben, muss das Opfer immer zweimal leiden. Einmal körperlich – in dem Moment, in dem es passiert – und einmal verbal, weil man seine Geschichte immer und immer wieder erzählen muss. Im System, in dem wir leben, wird das Opfer in seiner eigenen Erzählung gefangen gehalten. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, dass die Art und Weise, wie wir Gewalt gesellschaftlich regeln, nicht einfallsreicher ist. Wieso könntest du z.B. nicht, wenn ich dir das, was ich durchleben musste, präzis erzählt habe, die Anzeige für mich erstatten. Ich weiß, das ist ein absurdes Beispiel, aber es erscheint mir kaum absurder als die Gegebenheit, dass das Opfer ein zweites Mal leiden muss. Des Weiteren frage ich mich, wieso das Verzeihen in unserer Gesellschaft verboten ist. Du kannst der Polizei nicht erklären: Ich will nicht, dass mein Angreifer bestraft wird. Ich will damit nicht sagen, dass jeder dem anderen verzeihen muss. Das wäre ja auch wieder eine totalitäre Herangehensweise. Aber ich empfinde es als störend, dass es eine einzige Art und Weise gibt, Gewalt gesellschaftlich zu behandeln. Wenn du dann später zum Arzt gehst, wird die Sache nur noch schlimmer: Dein Körper wird nach Spuren untersucht, er sagt aus, ganz gleich, ob du das nun möchtest oder nicht. Es gibt heute eine totalitäre Art und Weise, die Frage der Gewalt zu behandeln, in der das Opfer keinen Platz mehr einnehmen kann. Der Staat stiehlt ihm seine Geschichte.
In deinem Buch vergleichst du den „Autismus“ derjenigen, die alles im Gedächtnis behalten möchten mit dem „Autismus“ derjenigen, die alles vergessen wollen. Dies erinnert an Ishiguros „The Buried Giant“, ein Roman, im Laufe dessen der Autor über die Gefahren des Gedächtnisses reflektiert – Vergessenheit kann auch manchmal den Zyklus der Gewalt durchbrechen …
Nachdem, was ich erlebt habe, habe ich versucht, mir ein nicht destruktives Gedächtnis aufzubauen. Es gibt immer Leute, die vergessen, unterdrücken wollen, und es gibt Leute, die nachforschen möchten. Auch hier sehe ich wieder ein Problem in der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft konzipiert ist: Es gibt institutionell gesehen ein einziges Modell, das vorschreibt, wie mit traumatischen Erlebnissen umzugehen ist. Weswegen es mir wichtig erscheint, ein System zu schaffen, in dem es keine einzige, sondern eine vielfältige Art und Weise gibt, mit Gewalt umzugehen. Wenn ich eine Zeugenaussage über einen Akt der Gewalt ablege, reagiert das System mit einem Zuschuss an Gewalt: Man will bestrafen, wegsperren. Dabei weiß jeder, dass unser Strafsystem einer der Hauptauslöser von Gewalt und Unsicherheit ist. Die Mehrheit der Verantwortlichen von Terroranschlägen wurde irgendwann wegen mehr oder weniger harmloser Delikte inhaftiert – und dann im Gefängnis radikalisiert. Das Strafsystem bringt uns Unsicherheit – ich habe dies selbst miterlebt, weil mein Cousin Sylvain im Gefängnis landete, durchdrehte, ausbrach, wieder eingefangen wurde und dort starb. Aber es scheint, als wäre unsere Lust am Bestrafen größer.


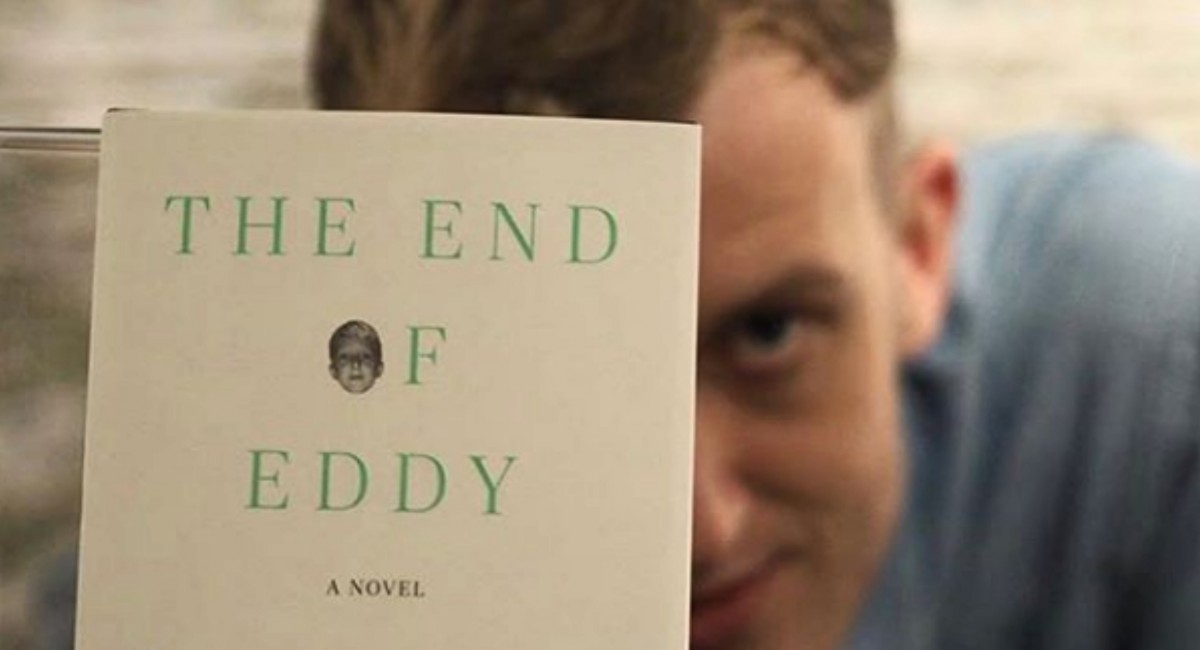







Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können