Was sollte man sich anhören und was nicht? In unserer Rubrik Klangwelten nehmen Kulturredakteure und Korrespondenten neue Alben unter die Lupe. Diesmal mit einer hässlichen Platte von Xiu Xiu, der massenkompatibelen Musik von Blood Red Shoes und der Editors-Kopie White Lies.
Von Jeff Schinker und Kai Florian Becker
„It’s a bad time to be a duck“: Girl With Basket Of Fruit von Xiu Xiu


Xiu Xius „Girl With Basket Of Fruit“ ist die hässlichste Platte, die wir dieses Jahr hören werden. Angenehm ist die Musik auf Jamie Stewarts 13. Platte ganz bestimmt nicht – sie ist manchmal sogar kaum auszuhalten. Dafür ist sie mutig und eindringlich. Jamie Stewart hat definitiv einen Knall. Wer sich an den Xiu-Xiu-Auftritt im Exit 07 vor einigen Jahren erinnern kann, hat wohl noch das Bild eines Typen, der frenetisch einen Game-Boy malträtiert, um aus diesem pluckernde Sounds herauszukitzeln, vor sich. Mit seiner Band Xiu Xiu vertont Stewart seit jeher die sozialen Abgründe des Neoliberalismus (auf einem Song, betitelt „Factory Girl“, singt er: „You won’t go to heaven, you’ll just go to work“) und schnitt lange vor dem #metoo-Dammbruch Themen wie sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen an. Titel wie „I Love Abortion“ oder „Born To Suffer“ (von der Platte „Always“) deuten bereits darauf hin, wie dunkel die Welt von Xiu Xiu meist ist beziehungsweise welche Aspekte der Wirklichkeit in ihr dargestellt und verarbeitet werden.
Im Laufe der letzten paar Platten hatte Stewart die Vollendung seines stilistischen Schaffensprozesses erreicht: Er schrieb recht schöne Songs, die teilweise auch ein klassischer Singer-Songwriter hätte produzieren können – und zerstückelte sie später mithilfe von Störgeräuschen, Beats, verzerrten Stimmen und komischen Synthie-Sounds. Für „Girl With A Basket Of Fruit“ entschied sich Stewart für eine radikale Frischzellenkur – einerseits, um die drohende künstlerische Stagnation zu vermeiden, andererseits aber auch, damit Form und Inhalt harmonieren. Wobei harmonieren hier sehr relativ ist: Auf den teilweise strukturlosen Songs schreit und flüstert Stewart, einsame Synthies flirren in trostlosen Klanglandschaften („It Comes Out As A Joke“), die Beats sind meist treibend, dringlich, Melodien sind selten, manchmal klingen die Songs wie Peaches auf MDMA und/oder Speed („Pumpkin Attack On Mommy And Daddy“), mal werden Jazz-Elemente („Ice Cream Truck“), mal Streicher („Amargi Ve Moo“) in die verzerrten Klangwelten von Stewart verstreut.
Schön ist das selten, spannend, experimentell und intelligent aber zu jedem Zeitpunkt. Grandios ist vielleicht das falsche Wort – und trotzdem schleicht sich der Gedanke im Laufe des wahnwitzigen „Scisssssssors“ ein, dass wir es hier mit einem sicherlich verrückten Genie zu tun haben. Der Plattentitel ist eine Anspielung auf Caravaggios „Boy With A Basket Of Fruit“, Stewart kommentiert den Albumtitel, indem er darauf hinweist, dass männliche Märtyrer in der Kunstgeschichte meist von besorgten Engel- und Mutterfiguren umgeben sind, wohingegen weibliche Leidensfiguren gehäutet, erstochen und immer nur von ihren Mördern begleitet sind. Die ganze Platte ist ein abstoßender, traurig-wütender Kommentar über die Gewalt, die oft ungestraft an Frauen verrichtet wurde – und immer noch wird.
Der Opener „Girl With A Basket Of Fruit“ beginnt folgendermaßen: „The pressure rips her apart/The baby duck in you has died/Push it out and F-word a duck/ It’s a bad time to be a duck.“ Wenig später singt Stewart „The cutlass is a more excellent guest“, bevor es dann noch expliziter wird: „Look at her try to walk away, I get bored/(…) It’s a vagina strained without end/And her lungs fill with tears.“ Da wo andere weiterhin über romantische Liebe singen, als hätte es Weinstein und Konsorten nie gegeben, als würden nicht täglich neue Übergriffe stattfinden, konfrontiert Stewart die Themen mit seinen surrealistischen, beklemmenden Texten. Musste man sich früher auf einer Xiu-Xiu-Platte die musikalische Schönheit innerhalb der Lärmschichten erarbeiten, sie quasi wie ein Höhlenforscher ausheben, findet man bei der Erforschung von „Girl With A Basket Of Fruit“ fast nur Dreck. Faszinierend und mutig ist das durchaus – und die wenigen versteckten Momente der Schönheit – „The Wrong Thing“, „Normal Love“ – erklingen deswegen umso hoffnungsvoller.
Massenkompatibel: Get Tragic von Blood Red Shoes


Es gab Zeiten, da hatten Blood Red Shoes richtig Feuer. Das war anno 2007 mit der Single „I Wish I Was Someone Better“ der Fall. Und mit „Light It Up“ von ihrem zweiten Album „Fire Like This“ sowie „An Animal“ vom 2014er Album „Blood Red Shoes“. Dröhnende, verzerrte Gitarren und ein angenehm schnelles Tempo; es war Lärm in seiner schönsten Form und mit eingängigen Melodien gespickt. Das waren die Markenzeichen des aus Brighton stammenden Duos um Laura-Mary Carter und Steven Ansell. Sie an der Gitarre und am Gesang, er hinterm Schlagzeug und ebenfalls mit Gesangsmikrofon ausgestattet. Ende Januar haben Blood Red Shoes ihr fünftes Album „Get Tragic“ veröffentlicht. Auf diesem ignoriert die Band ihre eingangs beschriebenen Markenzeichen weitestgehend und serviert einen gefälligeren, massenkompatibleren Sound. Es braucht zwei Lieder, ehe sie annähernd zu ihrem alten Stil zurückfinden („Bangsar“). Es ist mal wieder die immer gleiche Frage: Soll man eine Band verteufeln, wenn sie sich verändert hat, oder soll man froh sein, dass sie nicht in der künstlerischen Sackgasse gelandet ist? Wäre denn ein Mittelweg die bessere Alternative? Letztlich haben Blood Red Shoes die letzte Option gewählt. Die Neuausrichtung hat sicherlich damit zu tun, dass sich nach ihrem letzten Album die Wege von Carter und Ansell für drei Jahre getrennt hatten und sie sich mit ihrem Comeback musikalisch neu finden wollten.
Die Aggression ist größtenteils raus; die Melodien und Gitarren sind noch da. Dazu gesellen sich düstere Synthesizer-Klänge und eine Prise Melancholie: siehe „Nearer“, in dem die Psychedelic/Garage-Rocker The Wytches mitwirken. Weitere Gäste auf dem von Nick Launay (Yeah Yeah Yeahs, Arcade Fire, Nick Cave & The Bad Seeds) produzierten Album sind Ed Harcourt (in der Achtziger-New-Wave-Ballade „Beverly“) und die Electro-Funk-Singer-Songwriterin Clarence Clarity („Find My Own Remorse“). Wer die Enttäuschung über den softeren Sound zu verdauen vermag, kann sich vielleicht an „Get Tragic“ erfreuen. Ein Reinfall ist das Album keineswegs – nur eben anders.
Von Bands, die die Welt nicht braucht: Five von White Lies

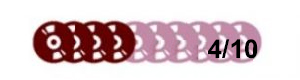
White Lies kopieren die Editors, die ihrerseits Experten im Interpol-Plagiat sind – und alle würde es ohne Joy Division und New Order nicht geben. Dieses Verfahren ist in der Popmusik weder neu noch dramatisch – im Recycling-Prozess sind die Songs der White Lies aber leider verdammt blass geworden. Es gibt Bands, deren Existenzberechtigung von Anfang an eher zweifelhaft ist. Bands, denen es durch puren Zufall gelang, sich in der zeitgenössischen Popmusik breitzumachen. Die nur auffallen, weil sie zum richtigen Zeitpunkt auf den Trendzug aufgesprungen sind. Bei denen man sich bei jeder neuen Platte sagt: Stimmt, die gibt’s ja auch noch. Die Kaiser Chiefs sind eine solche Band: Während der Glanzzeit des Indierocks zur Jahrtausendwende mischten sie ihren hymnischen Britpop wie ein trojanisches Pferd unter die Menge. Mumford & Sons’ Folk-Plattitüden funktionierten nur, weil das Singer-Songwriter-Genre gerade gut ankam. Und White Lies haben 2009 vom Comeback des New Wave profitiert, um sich einen Platz im Indie-Genre zu sichern.
Damals dachte niemand, dass die Band zehn Jahre und fünf Platten später noch existieren würde – die fünf Musiker wohl selbst auch nicht, betrachtet man mal, wie belanglos die neun Songs, die diese Scheibe, die man platterweise dann auch einfach „Five“ genannt hat, ausmachen. Hier werden mal wieder die ewig gleichen Ideen durchdekliniert, das Ganze kann man irgendwo zwischen blutarmem Postpunk und harmlosem New Wave einräumen. Der Opener „Time To Give“ ist über sieben Minuten lang, man fragt sich, wieso – an der Ideenvielfalt kann’s nicht liegen. „Never Alone“ ist eine The-Killers-B-Seite, danach plätschern Tracks wie „Finish Line“ und „Kick Me“ nett, aber einfallslos daher. Im Gegensatz zur hier besprochenen Xiu-Xiu-Platte tut auf „Five“ nichts weh.
Die White Lies werden niemandem im Kopf herumspuken – denn sie machen Musik für Leute, denen Musik eigentlich egal ist.








Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können